1. Treffen Flüchtlinge/Fluchthelfer am 9. November 2009
Flüchtlinge - Sperrbrecher - Fluchthelfer - Freigekaufte - Ausgebürgerte
An alle Flüchtlinge und Fluchthelfer durch die Berliner Mauer!
Gerade am Tag des Mauerfalls, am 9.11.09, wollen wir wahrgenommen werden als eine Gruppe von Menschen, die an die DDR, an die Mauer, an den Fall der Mauer und an die Wiedervereinigung eine ganz eigene Erinnerung haben - keine Ostalgie, aber große Freude, dass wir uns schon damals für die Freiheit entschieden haben! Wir alle sind froh darüber, dass wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat und in Freiheit leben dürfen! Und viele von uns feiern den Tag ihrer Flucht noch heute als ihren zweiten Geburtstag!
Zur Feier des für uns alle sehr wichtigen Tages treffen wir uns um 19 Uhr an einem der geschichtsträchtigsten Orte in Berlin, in der Bernauer Straße, in der Versöhnungs-Kapelle.
Programm (Beginn 19 Uhr):
- Begrüßung in der Versöhnungskirche: Pfarrer Manfred Fischer
- Begrüßung im Namen der Freiheit, für die wir alle eingetreten sind: Prof. Ingrid Stahmer
- Historischer Überblick über die Fluchten durch die Berliner Mauer: Dr. Maria Nooke
- Erklärungen zum Treffen und zum weiteren Procedere: Dr. Burkhart Veigel
- Ende gegen 20 Uhr.
...
Burkhart Veigel (damals "der Schwarze")
Reden
Frau Nooke musste ihren Vortrag vorziehen, weil Frau Stahmer leider nicht rechtzeitig da sein konnte. Sie sollte so vorgestellt werden:
Frau Nooke konnte erst nach dem Fall der Mauer ein Studium aufnehmen. Seit 1999 hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in leitenden Funktionen die Gedenkstätte Berliner Mauer maßgeblich mit aufgebaut. Durch vielfältige Kontakte zu Fluchthelfern und Flüchtlingen und durch ihre intensiven Recherchen ist sie heute eine Expertin in Sachen Fluchthilfe - obwohl sie nie dabei war. Viele Erkenntnisse über die Mechanismen des Grenzregimes, die Motive von Flüchtlingen und die Abläufe von Fluchtversuchen konnte sie in ihrem gerade abgeschlossenen Projekt zu den Todesopfern an der Berliner Mauer sammeln. Das Buch dazu hat sie zusammen mit Herrn Dr. Hertle vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam herausgegeben.
Vortrag (liegt nicht schriftlich vor; deshalb hier nur Zusammenfassung):
Trotz der hermetischen Abriegelung der Grenzen zwischen der DDR und West-Berlin gelangen zu allen Zeiten Fluchten durch die Mauer, zuerst sehr viele, später immer weniger. Die Wege dazu waren sehr unterschiedlich: Pass-Touren, auf Ähnlichkeit und mit Fälschungen, Tunnel, die Kanalisation, umgebaute Autos, Diplomaten. Die Kreativität der Flüchtlinge und der Fluchthelfer war unerschöpflich. Exakte Zahlen, wie viele Fluchten wann und auf welchen Wegen stattfanden, kann man aber bis heute nicht nennen.
...
Wir haben uns heute hier getroffen, weil ich meine, dass der 9.11.09 vor allem UNSER Feiertag ist: Wir waren die, die sich schon ganz früh für die Freiheit engagiert haben, als Andere noch die Brüder und Schwestern aus dem Osten wortreich, aber tatenlos bedauerten oder der antifaschistische Schutzwall als Friedenssicherung begrüßt wurde.
Ich darf das so ausdrücken:
- Es gibt Symbole der Diktatur: Mauer und Stacheldraht;
- aber es gibt kein Symbol der pluralistischen Demokratie.
- Es gibt Symbole der Unfreiheit: Hohenschönhausen, Bautzen II, der springende Schumann an der Bernauer Straße;
- aber es gibt kein Symbol der Freiheit!
Aber nein, das stimmt doch nicht so ganz: Wir habe die Freiheits-Statue in den USA, aber wir haben seit heute vor allem UNS! WIR stehen für die Freiheit! Unser Wille, frei zu sein, war unser Motor, der uns zu Taten bewegt hat, die heute noch vielen Nachgeborenen das Blut in den Adern gefrieren lässt!
Und deshalb wäre es schön, wenn wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden würden als die Gruppe von Menschen, die für erlebte und erarbeitete Freiheit steht! Wir haben Freiheit nicht proklamiert oder angemahnt, wir haben sie gelebt und erlebt! Und stehen heute deshalb auch manchmal fassungslos da, wenn wir sehen, dass manche Menschen für ihre Sicherheit ihre Freiheit hergeben. Das erinnert mich doch sehr an das Bild des Sklaven, der nie aus seiner Rolle des Gedemütigten herauskommt, weil ihm diese Rolle zu lange eingetrichtert wurde.
...
Frau Prof. Ingrid Stahmer war von Januar 1989 bis 1999 Senatorin für verschiedene Bereiche im Berliner Senat, insgesamt für Gesundheit, Soziales, Schule, Jugend und Sport. 1989/1990 war sie auch Bürgermeisterin, d.h. Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters. IHR in erster Linie fiel es zu, den Strom der Flüchtlinge vor der Wende zu kanalisieren: Sie fand Turnhallen und die zugehörigen Hausmeister von Schulen, sie fand Notbetten, sie fand Decken, und sie fand karitative Organisationen, die sich um das leibliche Wohl der vielen "Übersiedler" und der vielen vom Sozialismus Geschädigten und Enttäuschten kümmerten.
Nach der Wende ging es darum, innerhalb von 10 Tagen 10 Millionen neugierige Besucher West-Berlins aus der ganzen DDR zu begrüßen und das vielfältige Chaos der Warteschlangen für das Begrüßungsgeld, der fehlenden Toiletten und der längst nicht ausreichenden Verkehrsmittel so zu organisieren, dass das übervolle West-Berlin noch bewohnbar blieb.
Gerade in der kritischen Phase des Umbruchs war es vor allem ihr und ihrem unermüdlichen Engagement zu danken, dass die friedliche Revolution des Ostens im Westen eine glückliche Antwort fand. Heute hilft sie als Beirat der Gedenkstätte mit, die Erinnerung an diese bewegenden Monate, aber auch an die Schrecken einer menschenverachtenden Diktatur, wach zu halten.
Vortrag (liegt leider nicht schriftlich vor; deshalb nur sinngemäß und stark gekürzt):
Einleitend sagte Frau Stahmer, dass sie durchaus eine VIP-Karte zur offiziellen Feier der Stadt Berlin am Brandenburger Tor habe, zusammen mit Gorbatschow, Sarkozy, Hillary Clinton etc., dass sie aber lieber zu uns gekommen sei, weil unser Anliegen auch das ihre sei: für die Freiheit einzustehen. (großer Beifall) Sie selbst stehe für ein selbst bestimmtes Leben in der Gemeinschaft und für die Freiheit von Ungerechtigkeit und Aussonderung. Sie habe sich deshalb sehr über die Einladung von Burkhart Veigel gefreut, und es sei ihr eine Ehre, hier reden zu dürfen.
Dann stellte sie fest, dass es für die Jahre 1961 bis ca. 1975 historisch eine Lücke der Wahrnehmung gäbe. Für diese Jahre, in denen die DDR die Daumenschrauben besonders eng an-gezogen hatte, hätte man keine oder fast keine Zeitzeugnisse, keine Schilderungen, wie es der Bevölkerung in Ost und West gegangen sei. Deshalb sei es jetzt unsere Aufgabe, die Aufgabe der Flüchtlinge und auch der Fluchthelfer, zu reden über sich und die Zeit damals. Wir müssten an die Öffentlichkeit gehen, weil wir wichtige Zeugen vor allem der Welt vor 40 Jahren seien.
Was die Diktatur in der DDR für die Menschen bedeutete, habe sie schlagartig begriffen, als sie ihren Vetter in Pankow einmal fragte, was für Wünsche er habe; er sagte, er wolle nur möglichst schnell 65 werden, 65, um ausreisen zu können. Jeans, Kaffee oder Klopapier waren ihm nicht wichtig; er wollte "nur" frei sein. Wir hätten uns schon damals für diese Freiheit eingesetzt, für die eigene oder die von anderen Menschen, auch wenn das mit erheblichen Risiken verbunden war. Warum die Fluchthelfer das getan hätten, hätte sie vor allem durch Bodo Köhler erfahren. Auf diese Weise sei ihr auch besser klargeworden, was Freiheit und Unfreiheit für die Menschen in der DDR bedeuteten.
Und deshalb sei sie froh, bei uns sein zu können, bei den Menschen, die auch unter Risiken und Opfern die Freiheit gesucht hätten. Wir hätten uns eben nicht kritiklos dem westlichen System entgegengeträumt, sondern sehr viel für die reale Freiheit der Menschen getan. Und darüber müssten wir erzählen! "Erzählen Sie Ihre Geschichte! Es ist wichtig für das historische Gedächtnis dieser Gesellschaft, und es ist wichtig für die Jugend, die wir nicht im Dunkel des Nicht-Wissens zurücklassen sollten!"
Bilder

"Ohne Ostalgie: Fluchthelfer treffen sich in der Bernauer Straße - Das wollen sie öfter machen, das nächste Mal zum 13. August 2010, dem Tag des Mauerbaus. Am Abend des 9. November aber, als die meisten zur großen Feier am Brandenburger Tor schauten, trafen sich ehemalige Flüchtlinge in der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße. Voll war es und, wie Burkhart Veigel erzählt, der als Medizinstudent zwischen 1961 und 1970 Fluchthelfer in Berlin war, bewegend. Maria Nooke von der Gedenkstätte Berliner Mauer gab einen historischen Überblick über die Fluchthilfe. Die meisten konnten sich aber nur allzu gut erinnern, wie es war: rauswollen, helfen können. Veigel sagte, es gebe viele Symbole für Diktatur und Unterdrückung, aber relativ wenige Symbole für die pluralistische Demokratie und für die Freiheit. So sollten die Flüchtlinge und ihre Helfer sich als Erinnerung daran sehen, dass Menschen auch in Diktaturen eine Unverfügbarkeit behalten. 2007 zog Veigel, der Arzt in Stuttgart war, zurück nach Berlin, um für ein Buch über Fluchthilfe zu recherchieren. Er hat eine Internetseite (www.fluchthilfe.de) installiert, Interviews geführt. Seiner Ansicht nach sollen die Flüchtlinge und die Fluchthelfer viel stärker die Öffentlichkeit suchen: "Von uns ist niemand ostalgisch." (mk)
Tagung des Autorenkreises der Bundesrepublik 28. bis 30. Mai 2010
20 Jahre wiedervereinigt – Versuch einer Bestandsaufnahme
Öffentliche Tagung des AUTORENKREISES DER BUNDESREPUBLIK
in Kooperation mit der Konrad–Adenauer–Stiftung
Tiergartenstr. 35, 10785 Berlin (Tagungsort)
28. – 30. Mai 2010
Gefördert vom Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
Freitag, 28. Mai 2010
| 18.00 Uhr | Begrüßung Andreas Kleine-Kraneburg Leiter der Akademie der Konrad–Adenauer–Stiftung |
| Dr. Jörg Sader Vorsitzender Autorenkreis der Bundesrepublik I. Lesungen zum Thema Ost/West |
|
| 18.15 – 19.00 Uhr | Grit Poppe: „Weggesperrt“ Lesung und Diskussion |
| 19.00 – 19.30 Uhr | Imbiss |
| 19.30 – 20.15 Uhr | Helga Schubert: „Übungen in Distanz“ Lesung und Diskussion |
| 20.15 – 21.00 Uhr | Christoph Kuhn: „Königsweihe“ Lesung und Diskussion |
Samstag, 29. Mai 2010
| 9.30 – 9.45 Uhr |
Dr. Burkhart Veigel II. Der Ist–Zustand |
| 9.45 – 10.30 Uhr | Dr. Hendrik Berth Einheitslust und Einheitsfrust Diskussion |
| 10.30 – 11.15 Uhr | Dagmar Heuling Was wissen Schüler in Ost und West von Ost und West? Ergänzungen zur bekannten Studie von Prof. Klaus Schroeder Diskussion |
| 11.15 – 11.45 Uhr | Kaffeepause |
| 11.45 – 12.30 Uhr |
Dr. Gregor Weißflog III. Grundlagen des Kommunismus: Ein philosophisches Seminar |
| 12.30 – 13.15 Uhr | PD Dr. Hendrik Hansen Die Kapitalismuskritik von Karl Marx – Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft? Diskussion |
| 13.15 – 14.00 Uhr | Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig Karl Marx: Humanist oder Wegbereiter des totalitären Staates? Diskussion |
| 14.00 – 15.00 Uhr | Mittagessen |
| 15.00 – 15.45 Uhr | Dagmar Heuling Ist Gleichheit generell und gerecht realisierbar? Oder führt die Realisierung direkt in eine Diktatur? Diskussion |
| 15.45 – 16.30 Uhr | Dr. Michael von Prollius Sozialismus, die Wirtschaftsordnung ohne Privateigentum – und ohne Perspektive? Diskussion |
| 16.30 – 17.00 Uhr | Kaffeepause |
| 17.00 – 17.45 Uhr | Rita Quasten Marxismus/Leninismus: Heilbotschaft oder Alptraum? Diskussion |
| 17.45 – 18.30 Uhr |
Udo Scheer VI. Wie können wir die Aufklärung zu einer besseren Aufarbeitung einsetzen? |
| 18.30 – 19.45 Uhr | Podiumsdiskussion mit den Referenten des Seminars Moderation: Dr. Burkhart Veigel Diskussion |
| 19.45 – 20.30 Uhr | Imbiß |
| 20.30 Uhr | Der Revolutionstisch – eine soziale Plastik Film von Edith Tar und Radjo Monk, gefördert durch die Stiftung Aufarbeitung SED–Diktatur und die Stadt Leipzig in Kooperation mit der Denkmalschmiede Höfgen GmbH Kulturraum Leipziger Raum und die Gesellschaft für Landeskultur e.V. (45 Minuten, 16 : 9, 2009) |
Sonntag, 30 Mai 2010
V. Hatte ein Dritter Weg eine Chance, hätte er eine haben müssen? |
|
| 10.00 – 10.45 Uhr | Gespräch zwischen Dr. Andreas A. Apelt, Stephan Hilsberg und Dr. Erhart Neubert Diskussion |
| 10.45 – 11.00 Uhr | Zusammenfassung der Referate vom Vortag Dr. Burkhart Veigel |
| 11.00 – 11.30 Uhr |
Kaffeepause VII. Was können wir, was könnte die Politik in der geschilderten Situation tun? |
| 11.30 – 13.00 Uhr | Gesprächsrunde mit Prof. Ingrid Stahmer, Dr. Andreas A. Apelt, Dr. Ehrhart Neubert, Stephan Hilsberg und weiteren Teilnehmern Moderation Sven Felix Kellerhoff Diskussion |
| 13.00 – 13.30 | Imbiß |
Tagungsleitung: Dr. Burkhart Veigel
Tagungsassistenz: Dr. Clemens Brüggemann
Dr. Andreas H. Apelt
Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin
dg@deutsche-gesellschaft-ev.de
Dr. rer. medic. habil. Hendrik Berth, Dipl.-Psychologe
Komm. Leiter Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universität Dresden
berth@wiedervereinigung.de
PD Dr. Hendrik Hansen
Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte, Universität Passau
hendrik.hansen@uni-passau.de
Dagmar Heuling
wiss. Mitarbeiterin im Forschungsverbund SED-Staat der FU Berlin
heuling@zedat.fu-berlin.de
Stephan Hilsberg
ehem. Sprecher der SDP, ehem. Bundestags-Abgeordneter, Berlin
stephan-hilsberg@web.de
Sven-Felix Kellerhoff
Leitender Redakteur, Berlin
sven-felix.kellerhoff@axelspringer.de
Andreas Kleine-Kraneburg
Leiter der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin
andreas.kleine-kraneburg@kas.de
Christoph Kuhn
Schriftsteller, Halle
info@kuhn-christoph.de
Dr. Ehrhart Neubert
ehem. Pfarrer, Dissident, CDU-Mitglied, Bürgerbüro e.V., Erfurt
hild.neubert@arcor.de
Grit Poppe
Schriftstellerin, Potsdam
gritpoppe@aol.com
Dr. Michael von Prollius
Publizist, Gründer des Forum Ordnungspolitik, Leiter des Wissenschaftskreises der Hayek-Gesellschaft, Berlin
mvp@prollius.de
Rita Quasten
wiss. Mitarbeiterin im Forschungsverbund SED-Staat der FU Berlin
rquasten@zedat.fu-berlin.de
Dr. Jörg Sader
Vorsitzender des Autorenkreises der Bundesrepublik, Frankfurt/M
joerg.sader@web.de
Udo Scheer
Publizist und Schriftsteller, Stadtroda
scheeru@web.de
Helga Schubert
Schriftstellerin, Neu–Meteln
Schubert-Helm@web.de
Prof. Ingrid Stahmer
1989/90 Stellvertretende Bürgermeisterin von Berlin, 1989/1999 Senatorin für Gesundheit, Soziales, Schule, Jugend und Sport, Berlin
mail@ingrid-stahmer.de
Edith Tar und Radjo Monk
Schriftsteller, Videokünstler und Filmemacher, Leipzig
monk.tar@gmx.de
Dr. Burkhart Veigel
Vorsitzender des Vereins des Autorenkreises der Bundesrepublik, ehem. Fluchthelfer, Berlin
bv@dr-veigel.de
Dr. Gregor Weißflog
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Universität Leipzig
Gregor.Weissflog@medizin.uni-leipzig.de
Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig
Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte, Universität Passau
zehnpfennig@uni-passau.de
Reden
Eröffnungsrede
Unsere letztjährige Frühjahrstagung mit dem Titel „Aufarbeitung der Aufarbeitung“, organisiert von Ines Geipel und Andreas Petersen, hat mir und den vielen anderen interessierten Teilnehmern sehr gut gefallen, und als es sich durch einige Zufälle ergab, dass ich zur diesjährigen Tagung etwas beitragen könnte, dachte ich zunächst daran, das Thema Aufarbeitung aufzugreifen, z.B. durch das Aufzeigen der unterschiedlichen Aufarbeitung in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Als ich aber auf einer Tagung in Höhenschönhausen Frau Heuling und Herrn Hansen sprechen hörte, und als ich in der Folge noch einige Gespräche mit Frau Heuling hatte, dachte ich eher an ein Thema in der Art: Erst aufklären, dann aufarbeiten. Um unsere Freunde nicht abzuschrecken, haben wir dann den „harmloseren“ Titel für die Tagung genommen: „20 Jahre wiedervereinigt – Versuch einer Bestandsaufnahme“.
Aber das Grundmotto unserer Tagung bleibt trotzdem, der Aufarbeitung die Aufklärung voranzusetzen. Aufarbeiten heißt ja, festzustellen, dass das und das nicht gut war, dass das und das nicht funktioniert hat; aufklären heißt, zu klären, ob es grundsätzlich eine Chance gab, dass es hätte funktionieren können, mit etwas mehr gutem Willen, unter anderen Umständen etc.. Wenn dabei herauskommt, dass die Ideen des Kommunismus an sich richtig und gut waren, nur die Ausführung schlecht, sollte man überlegen, welche Faktoren ein Gelingen verhindert haben und ob es möglich wäre, diese Faktoren zu ändern. Wenn aber dabei herauskommt, dass es so oder so nie hätte gelingen können, von Anfang an, dann sollte man den Müllhaufen der Geschichte, auf dem der Kommunismus z.Z. liegt, nicht noch einmal aufsuchen, um die Scherben eines vergangenen Systems zusammenzukleben. Und wenn trotzdem jemand dieses Bedürfnis hat, kann man das einordnen unter der Rubrik: Die Menschen träumen eben lieber als dass sie denken.
Alle müssen träumen dürfen, von einer besseren Welt, vom Kommunismus, von einer universellen Gleichheit, von einer antikapitalistischen Welt, von einer antifaschistischen Welt, von einem Verschwinden der NATO, vom ewigen Frieden, davon, dass alle Arbeit haben. Wir sollten nur wissen, dass das alles Schlupflöcher für unsere Seele sind, in denen sie sich kurz erholen kann und darf; so haben auch Träume ihren berechtigten Platz. Aber unsere Aufgabe bleibt unverändert, die Welt so, wie sie ist, zu begreifen und das Beste aus ihr zu machen – für ALLE Menschen, mit denen wir doch in einem Boot sitzen!
In diesem Sinne habe ich versucht, den Ist-Zustand darzustellen durch die ersten Referate, und danach ein philosophisch-politisches Seminar durchzuführen zu einigen grundlegenden Ideen, die z.Z. gängiges Gedankengut sind, sich aber auch in der Ideologie von Diktaturen – wie den kommunistischen – wiederfinden. Ich hoffe, dass wir auf diese Weise zu unbestechlichen Argumenten kommen, denen die Nostalgiker eines gescheiterten Kommunismus, die Täter von damals und die wohlgemuten Ahnungslosen nicht viel entgegensetzen können. (Zur Erklärung, was ich unter wohlgemuten Ahnungslosen verstehe, lasse ich gerne Paul Spiegel sprechen: „Man kann nicht a priori Nein zum Krieg sagen. Die Konzentrationslager wurden auch nicht von Friedensdemonstrationen befreit, sondern von der Roten Armee.“ Ich meine also die Mitmenschen damit, die mit Lichterketten alle Probleme der Welt lösen, mit einem beträchtlichen Engagement, aber ohne ausreichende Informationen und ohne für diese Probleme ausreichenden Verstand).
Nachdem die juristische Aufarbeitung gescheitert ist und scheitern musste, sollten wir darauf dringen, eine moralische Aufarbeitung zu fördern mit dem Ziel, dass die Kinder und Klassenkameraden der Stasi- und SED-Täter ihre Eltern und Freunde fragen „Was hast Du getan? Wie kannst Du das rechtfertigen? Was können wir tun, um das Leid der Opfer wenigstens etwas zu lindern?“
Da wir alleine, wenn auch gut munitioniert mit den Ergebnissen der Tagung, nicht in der Lage sein werden, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, wollte ich das Thema auch an die Politik weitergeben: Vielleicht können wir den Politikern geistige Munition liefern, vielleicht können sie aber auch uns sagen, was wir unternehmen können und sollten, um die moralische Aufarbeitung vorwärts zu bringen.
Wenn wir das erreicht haben, werde ich glücklich sein! Deshalb wünsche ich der Tagung einen gelungen Verlauf mit vielen rauchenden Köpfen, heißen Diskussionen und glücklichen Abenden und Nächten!
Ein weltweit einmaliges Forschungsprojekt, in dem zunächst fast 1.300, heute noch 400 Menschen aus der ehemaligen DDR, Jahrgang 1973, jährlich seit 1987 zu ihrer Befindlichkeit befragt werden. Die Ergebnisse:
Heute lehnen ca. 80% der Befragten die DDR und das kommunistische System ab. Sie fühlen sich aber auch im Kapitalismus der Bundesrepublik nicht wohl, vor allem der allgegenwärtigen Arbeitslosigkeit wegen, die 2/3 der Teilnehmer selbst erfahren haben. Sie beklagen die Mängel in der Sozial-, Familien- und Gesundheitspolitik, engagieren sich politisch fast nicht mehr, fühlen sich als Bundesbürger zweiter Klasse und haben Angst vor der Zukunft.
Die Details lesen Sie bitte in der auch als Buch erschienen Studie zur "3. Generation Ost" nach:
Die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörungen von Opfern der Inhaftierung in der DDR ist besonders schwierig, weil diese Menschen neben der Folter in Haft auch danach noch "zersetzt" wurden und keinerlei Hilfe erfuhren, weil sie mehr oder weniger krank oder gar gebrochen aus der Haft kamen und heute nicht mehr die Kraft zu einer persönlichen Aufarbeitung haben und weil sie auch heute noch von der Gesellschaft vergessen und verdrängt werden.
Die Details lesen Sie bitte in der Studie nach:
Karl Marx ist wieder da. Nachdem in den neunziger Jahren kaum jemand etwas von ihm wissen wollte – einen Propheten, der offenkundig geirrt hat, will man nicht hören – haben die Finanzkrisen in den vergangenen zwei Jahren zu einem neu erweckten Interesse an Marx geführt: Marx wurde, so eine nicht nur unter Linken weit verbreitete Meinung, von den Bolschewiki und ihren Genossen in der DDR nur missbraucht; die totalitäre Zentralverwaltungswirtschaft war nicht sein Projekt. Er war vielmehr der große Theoretiker der Krisenanfälligkeit des Kapitalismus – der einzige Ökonom, der Wirtschaftkrisen nicht (wie die sogenannten Neoliberalen) ignorierte oder sie – wie Keynes – auf kontrollierbare Störungen reduzierte, sondern der die immanente Widersprüchlichkeit des Kapitalismus schonungslos aufzeigte und zugleich verdeutlichte, in welchem Ausmaß die Politik im Kapitalismus zu einer Marionette ökonomischer Interessen wird.[2]
Diese Einschätzung findet sich nicht nur bei Anhängern der Partei „Die Linke“, sondern auch bei Personen, die nicht im Verdacht stehen, Marxisten zu sein. So betonte Peer Steinbrück in einem Spiegel-Interview im Zusammenhang mit der Finanzkrise, dass „gewisse Teile der marxistischen Theorie doch nicht so verkehrt sind“, denn: „Ein maßloser Kapitalismus, wie wir ihn hier erlebt haben mit all seiner Gier, frisst sich am Ende selbst auf.“[3] Und der Erzbischof von München-Freising, Reinhard Marx, kokettiert mit seinem Namensvetter, indem er sein Buch „Das Kapital“ nennt und es mit einem freundlichen Brief an seinen großen Gegner und zugleich „lieben Namensvetter“ beginnt: „Ich schreibe Ihnen […],“ – so heißt es dort – „weil mir in letzter Zeit die Frage keine Ruhe lässt, ob es am Ende des 20. Jahrhunderts […] nicht doch zu früh war, endgültig den Stab über Sie und Ihre ökonomischen Theorien zu brechen“. [4] Karl Marx habe, so der Bischof, die negativen Auswirkungen der Globalisierung des Kapitalismus auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gesehen – und er habe ein ganz ähnliches Ziel wie die katholische Soziallehre verfolgt: Sie will wie Karl Marx „soziale Ungerechtigkeiten aufdecken und anprangern“ und sie möchte wie er „den Armen und Ausgebeuteten […] eine Stimme geben und ihnen zu ihrem Recht verhelfen“ (ebd., S. 12).
Angesichts der katastrophalen Wirkungen des Marxismus-Leninismus in der DDR und in den kommunistischen Staaten insgesamt, wo die Umsetzung der Ideologie annähernd 100 Millionen Tote,[5] zerfallene Städte und zerrüttete Seelen zurückgelassen hat, ist diese wohlwollende Einschätzung erstaunlich. Sie zwingt zu einer genaueren Auseinandersetzung mit Marx, denn angesichts dieser Katastrophen ist die aktuelle Renaissance der Marxschen Theorie eine bedenkliche Entwicklung. Ich werde im folgenden einen Aspekt der Theorie von Marx behandeln, der in der aktuellen Debatte immer wieder als seine bleibende Leistung dargestellt wird: die Krisentheorie des Kapitalismus. Nach der Darstellung dieser Krisentheorie im ersten Abschnitt befasst sich der zweite Abschnitt mit der Frage, inwiefern diese Theorie dem Anspruch einer ökonomischen Analyse des Kapitalismus gerecht wird. Auf der Grundlage der Kritik der Krisentheorie folgt abschließend eine Einschätzung, ob Marx’ Kapitalismuskritik den Weg in eine gerechtere Gesellschaft weisen kann.
I. Die Krisentheorie als Zentrum der Kapitalismuskritik von Marx
Die Krisentheorie von Marx beruht auf seiner Analyse des Akkumulationsprozesses des Kapitals und auf dem „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“. Die Grundlage für diese Theorien liefert wiederum die Arbeitswertlehre, die im „Kapital“ bewusst am Anfang steht. Die folgende Darstellung ist deshalb in vier Schritte unterteilt: 1. Arbeitswertlehre, 2. Akkumulation des Kapitals, 3. das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, 4. die Krisenneigung des Kapitalismus.
1. Arbeitswertlehre
Die Arbeitswertlehre zielt auf die Erklärung des Tauschwertes der Waren und setzt somit an der Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauschwert an. Jede Ware hat einen Gebrauchswert, insofern sie dazu nützt, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen.[6] Der Tauschwert hingegen ist vom Nutzen einer Ware und ihrem Gebrauchswert unabhängig; er bezeichnet eine Relation zwischen Waren und damit ein Gemeinsames, das es ermöglicht, unterschiedliche Waren miteinander zu vergleichen (ebd., S. 51). Das Gemeinsame besteht darin, dass alle Waren Produkte menschlicher Arbeit sind: Abstrahiert man von dem Gebrauchswert –der für alle Waren unterschiedlich ist –, so ist das Gemeinsame von Waren nur, „daß in ihrer Produktion menschliche Arbeit verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist.“ (ebd., S. 52) Die Rückführung des Tauschwerts einer Ware auf die „inkorporierte“ (also die für die Produktion aufgewandte) Arbeit stößt auf zwei Probleme, die Marx durchaus bewusst sind:
- Erstens darf der Maßstab für den Wert einer Ware nicht die effektiv aufgewandte Arbeit sein: Ein Produkt wird nicht dadurch wertvoller, dass es von einem besonders langsamen Arbeiter hergestellt wird. Der Maßstab ist vielmehr die „gesellschaftliche notwendige Arbeitszeit“ (ebd., S. 53), d. h. die bei der verfügbaren Technik („Produktionsbedingungen“) durchschnittlich erforderliche Arbeitszeit.
- Zweitens erfordert die Zurückführung des Tauschwerts der Waren auf Arbeit, dass es sich bei ihr um einen einheitlichen Wertmaßstab handelt. Da auch für Marx die Stunde Arbeit eines Ingenieurs einen höheren Wert hat als die eines Hilfsarbeiters, sollen die unterschiedlichen Qualitäten auf „gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit“ reduziert werden (ebd., S. 52): Unterschiedliche Qualitäten werden also jeweils als ein Vielfaches „einfacher Arbeit“ verstanden.
Alle Werte werden somit allein durch Arbeit geschaffen – weder die unternehmerische Findigkeit, noch das eingesetzte Kapital, noch die Natur haben einen Anteil an der Wertschöpfung.
2. Akkumulationsprozess
Die Arbeit ist in der Lage, mehr Werte zu schaffen, als erforderlich sind, um die Subsistenz des Arbeiters zu sichern, und das ist die Grundlage für den kapitalistischen Akkumulationsprozess. Im Regelfall bekommt der Arbeiter einen Lohn in Höhe des Existenzminimums; den Wert, den er über die Höhe seines Lohnes hinaus schafft (= Mehrwert) eignet sich der Kapitalist an; in dieser Aneignung des Mehrwerts besteht die Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten. Der Kapitalist wiederum wird durch den Wettbewerb gezwungen, einen großen Teil des Mehrwerts, den er sich angeeignet hat, zu reinvestieren, um seine Produktion auszudehnen . dadurch verwandelt er den Mehrwert in Kapital, also aufgehaufte Arbeit, die er akkumuliert.
Der Wettbewerb zwingt den Kapitalisten, seinen Kapitalbestand fortwahrend auszudehnen:
Die Akkumulation hat im Geschichtsverstandnis von Marx eine zweifache Bedeutung. Einerseits ist sie fur die Arbeiter negativ, weil die Macht der Ausbeuter gesteigert wird:
Andererseits werden durch den Akkumulationsprozess die Produktivkrafte weiterentwickelt, und davon will der Sozialismus nach der Revolution zehren:
3. Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate
Der Prozess der Akkumulation des Kapitals verlauft nun nicht gradlinig, sondern es kommt fortwahrend zu Krisen. Das hangt wesentlich mit dem Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate zusammen.[7] Marx geht davon aus, dass fur das Uberleben der Kapitalisten im Wettbewerb nicht der absolute Gewinn entscheidend ist, sondern das Verhaltnis des Mehrwerts, den er abschopft, zum eingesetzten Kapital. Dieses Verhaltnis bezeichnet er als Profitrate (Ĩ), die somit definiert ist als:
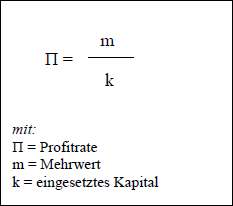
Das eingesetzte Kapital wird von Marx weiter unterteilt in das konstante Kapital (c, in heutigem Sprachgebrauch: fixes Kapital) und das variable Kapital (v):
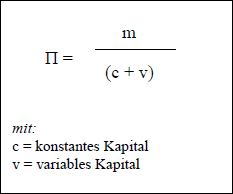
Das variable Kapital besteht vor allem aus den Löhnen und dient somit der Finanzierung der allein wertschöpfenden Arbeitskraft, während das konstante Kapital „tote Arbeit“[8] darstellt: Gebäude, Maschinen etc., in denen frühere Arbeit geronnen ist. Da nun allein die Arbeit Werte schafft, kann der Mehrwert der Produktion (m) nur im Umfang der Erhöhung des variablen Kapitals (v) steigen. Da nun der Akkumulationsprozess des Kapitals zu einer fortschreitenden Konzentration führt und damit der Umfang des konstanten Kapitals (c) stetig zunimmt, wächst der Nenner (c + v) notwendig in größerem Umfang als der Zähler (m). Das Verhältnis beider, die Profitrate, sinkt somit stetig.
Marx betont nun, dass diese Gesetzmäßigkeit nur als Tendenz gilt, denn es gibt „entgegenwirkende Ursachen“[9] – Maßnahmen, die die Kapitalisten ergreifen können, um auf die sinkende Profitrate zu reagieren. Zu den wichtigsten zählen die „Erhöhung des Exploitationsgrades der Arbeit“ und die Senkung des Arbeitslohnes: Wenn die Arbeiter genötigt werden, für den gleichen Lohn schneller zu arbeiten, steigt der Mehrwert m, ohne dass die Lohnkosten (d. h. der Nenner) sich verändern, so dass die Profitrate steigt. Wird der Arbeitslohn gesenkt, so sinkt der Wert des variablen Kapitals (und damit der Wert des Nenners) und die Profitrate steigt. Die gegenläufigen Ursachen können jedoch das mittelfristige Sinken der Profitrate nicht aufhalten, und so versuchen die Kapitalisten, zumindest das Niveau ihres Profits durch eine Ausweitung der Produktion zu halten.
4. Krisentheorie
Die Ausdehnung der Produktion führt zur Überproduktion. Dadurch, dass viele Waren nicht absetzbar sind, kommt es zu einem Einbruch der Profite und in der Folge zu einem Sturz der Aktienkurse an den Börsen. Die Krise bewirkt dann eine massive Kapitalentwertung. Zusammengefasst ergeben sich Krisen aus folgender Entwicklung:
- Im Wettbewerb kommt es zu einem Konzentrationsprozess;
- dadurch sinkt die Profitrate;
- auf die sinkende Profitrate reagieren die Kapitalisten mit einer Verschärfung der Ausbeutung und mit einer Ausweitung der Warenproduktion;
- die Überproduktion führt zu einer Krise, in deren Folge es zu einer massiven Kapitalentwertung kommt.
Aufgrund der tendenziell sinkenden Profitraten werden die Krisen immer gravierender; es kommt zu einer fortschreitenden Konzentration des Kapitals und zu einer zunehmenden Verelendung des Proletariats. Dadurch verschärft sich der Klassenkampf und es kommt letztlich – mit „eherner Notwendigkeit“[10] – zur proletarischen Revolution[11].
II. Ideologische Grundlage der Krisentheorie: Arbeitswertlehre und Klassenkampf
Was ist nun, in der Zusammenschau, das Spezifische an Marx’ Krisentheorie und an seiner Kapitalismuskritik? Zunächst fällt auf, dass die Krisentheorie von Marx die Funktion hat, den notwendigen Untergang des Kapitalismus zu erweisen. In der Krise spitzt sich der Klassenkampf zu; das ist der Grund, weshalb er sich für sie interessiert. Wer sich heute auf Marx’ Werke stützt, um dort Anhaltspunkte für die Erklärung der aktuellen Krise zu finden, wird höchstens fündig, wenn er die Prämisse teilen will, dass der Kapitalismus keine Zukunft hat.
1. Einwände gegen die Arbeitswertlehre
Diese Prämisse ist in empirischer Hinsicht gewagt, denn der Kapitalismus hat immer wieder bewiesen, dass Krisen seine grundsätzliche Produktivität nicht erschüttern können. Zudem resultiert die derzeitige Krise nicht aus dem Kapitalismus als solchem, sondern aus einer spezifischen Interaktion zwischen Regierungen (die, im Fall der USA, den Immobilienboom staatlich gefördert haben, oder im Fall Griechenlands eine maßlose Verschuldungspolitik betrieben haben), Notenbanken, die die Zinssätze sehr niedrig gehalten haben, und skrupellosen Investmentbankern, denen die Regierungen jedoch gerne zugesehen haben, solange sie Gewinne machten. Diese Zusammenhänge kann Marx’ Krisentheorie nicht erklären – es sei denn, man reduziert seine Kapitalismuskritik auf die schlichte Behauptung einer Beherrschung der Politik durch die Ökonomie.
In empirischer Hinsicht ist noch eine weitere Annahme der Krisentheorie fragwürdig: Das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate setzt voraus, dass es im Kapitalismus eine allgemeine Tendenz zur Konzentration gibt, so dass das konstante Kapital c im Vergleich zum variablen Kapital v stetig zunimmt. Diese Annahme ist, wie zahlreiche Untersuchungen beweisen, falsch, denn die Konzentration entwickelt sich in verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich; [12] zudem bezieht sich die von Marx behauptete Konzentration auf die Betriebe als Produktionsstätten; dort, wo tatsächlich besorgniserregende Konzentrationsprozesse zu beobachten sind, handelt es sich um Unternehmenskonzentration (also den Zusammenschluss mehrerer Betriebsstätten und nicht das Wachstum dieser Betriebsstätten selbst).
Gravierender ist jedoch der theoretische Mangel dieser Krisentheorie: Das Gesetz setzt die Arbeitswertlehre voraus, denn der Nenner des Quotienten, der die Profitrate beschreibt, steigt ja nur deshalb langsamer als der Zähler, weil eine Zunahme des Mehrwerts allein auf einen größeren Einsatz an variablem Kapital (also: an Arbeit) zurückzuführen ist, während das konstante Kapital als tote, geronnene Arbeit unproduktiv ist. Welche philosophische Bedeutung die Arbeitswertlehre hat, wird Prof. Zehnpfennig im folgenden Vortrag noch zeigen und damit auch verdeutlichen, dass das „Kapital“ nur im Zusammenhang mit Marx’ Frühschriften verstanden werden kann. Ich beschränke mich hier auf einige ökonomische Einwände gegen die Arbeitswertlehre, die in theoretischer Hinsicht absurd, aber in ideologischer Hinsicht für Marx von größter Bedeutung ist.
Theoretisch absurd ist die Arbeitswertlehre, weil sie behauptet, dass allein die Arbeit Tauschwerte schafft. Übersehen wird dabei:
- erstens, dass die Arbeit mit Hilfe von Maschinen und Werkzeugen (also: Kapital) viel größere Werte schaffen kann als ohne dieses Kapital;
- zweitens, dass manche Güter – z. B. Boden – einen Wert haben, ohne dass sie bearbeitet wurden;
- drittens, dass die unternehmerische Leistung, die Arbeit in bestimmte Verwendungen zu lenken, erheblichen Einfluss auf den Tauschwert der Güter haben kann.
Theoretisch absurd ist die Arbeitswertlehre zudem, weil sie die Reduzierbarkeit unterschiedlicher Arbeitsqualitäten auf Arbeitsquantitäten behauptet, ohne zu erklären, wie diese Reduktion von Qualität auf Quantität funktionieren soll. Als Antwort auf die Frage, wie „kompliziertere Arbeit“ in „multiplizierte einfache Arbeit“[13] umgerechnet werden soll, verweist Marx auf die Reduktion unterschiedlicher Qualitäten von Gütern auf Tauschwerte im Tauschhandel, in dem den Qualitäten Preise (Tauschwerte) zugeordnet werden. Doch dieser Verweis ist zirkulär, denn diese Reduktion der unterschiedlichen Güterqualitäten auf Tauschwerte ist es gerade, die mit der Arbeitswertlehre erklärt werden soll.
Marx selbst scheint von seiner Arbeitswertlehre irritiert zu sein, denn am Ende seiner Analyse des Arbeitswerts fällt ihm auf, dass die Arbeit doch nur dann einen Wert schafft, wenn das Produkt der Arbeit auch zu etwas zu gebrauchen ist:
Marx erkennt also, dass der Tauschwert einer Ware mit ihrer Nützlichkeit zusammenhängen muss, meint das Problem aber damit zu lösen, dass er Arbeit entsprechend definiert: Arbeit ist nur das, was nützliche Produkte schafft. Also: wertvolle Arbeit schafft Werte. An diesem Punkt hätte ein guter Analytiker sehen können, dass die Argumentation in einen Zirkel geraten ist – aber es ging Marx wohl nicht um eine Analyse: Es ging ihm um eine Ideologie.
2. Ideologische Bedeutung der Arbeitswertlehre
So widersprüchlich die Arbeitswertlehre ist, so notwendig braucht Marx sie für seine Kritik des Kapitalismus, denn nur auf der Grundlage dieser Lehre lässt sich die gesamte menschliche Geschichte auf einen Kampf zwischen Proletariern und Kapitalisten reduzieren. Nur wenn allein die Arbeit Werte schafft, folgt:
- dass die Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalisten illegitim ist,
- dass die Kapitalakkumulation die Anhäufung von Werten bedeutet, die Arbeiter geschaffen haben,
- dass durch die Verschärfung der Ausbeutung im Zuge der Kapitalakkumulation die Arbeiter von ihrer eigenen Schöpfung unterdrückt werden;
- und dass der Schlüssel zur Überwindung der Ausbeutung in einer revolutionären Veränderung der Besitzverhältnisse liegt: Die Arbeiter müssen sich die von ihnen geschaffenen Werte durch die Expropriation der Expropriateure[14] wieder aneignen.
Die Enteignung der Kapitalisten erfolgt in der gewaltsamen proletarischen Revolution, die jedoch nicht direkt zur Errichtung der vollendeten kommunistischen Gesellschaft führt, sondern zunächst zur Übergangsphase der „Diktatur des Proletariats“[15] – einer Phase, in der das Bewusstsein der Menschen, das noch von der Habsucht des Kapitalismus beherrscht wird, durch die neuen Produktionsverhältnisse umgewandelt wird und in der sich der neue, kommunistische Mensch unter der straffen Führung der Partei langsam herausbilden soll.
Marx’ Analyse des Kapitalismus zielt darauf, die Zuspitzung des Klassenkampfes, der die gesamte Geschichte der Menschheit bestimmt, in dieser entscheidenden Phase der Geschichte aufzuzeigen. Erst im Kapitalismus wird deutlich, dass der Klassenkampf die Geschichte vorantreibt und dass die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, die Marx mit „dämonischem Fleiß“[16] untersucht, nur auf eines hinwirken: dass das Proletariat mit Notwendigkeit die Macht erringen und das Gute durchsetzen wird und dass das Übel der Ausbeutung sich von selbst erledigt. Dialektik bedeutet bei Marx, dass der Mensch die Überwindung von Ausbeutung und Unrecht nicht zu seiner Aufgabe machen muss, sondern dass die Ursache dieser Übel, das Privateigentum, sich von alleine vernichtet.
Der Arbeitswertlehre kommt somit eine entscheidende Rolle bei der Reduktion aller sozialen (und allgemein: aller menschlichen) Phänomene auf den Klassenkampf zu. Darin liegt der ideologische Charakter von Marx’ ökonomischer Theorie: Er analysiert nicht ökonomische Entwicklungen, sondern er konstruiert ausgehend von der Setzung, dass nur die Arbeit Werte schafft, ein Bild vom Kapitalismus, dessen analytischer Wert mit dem Wert der Arbeitswertlehre steht und fällt. Ist letztere falsch, so bleibt vom Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate so wenig übrig wie von der Theorie, dass alle menschlichen Beziehungen im Kapitalismus Ausbeutungsbeziehungen sind. Man kann Marx noch nicht einmal zugutehalten, dass er im Gegensatz zu den Harmonielehren der ökonomischen Klassik und Neoklassik die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus erkannt habe – wenn man jemanden, der überall nur Klassenkampf wahrnimmt, zum Krisentheoretiker erhebt, dann müsste man auch Hitlers Ideologie vom Rassenkampf den Rang einer Konflikttheorie zugestehen.
III. Schlussfolgerung
Was bleibt vor diesem Hintergrund von Marx’ scheinbarem Anliegen, eine gerechtere Gesellschaft herbeiführen zu wollen? Diese Frage lässt sich erst vollständig beantworten, wenn seine Vision der kommunistischen Gesellschaft in die Auseinandersetzung einbezogen wird, was Prof. Zehnpfennig im anschließenden Vortrag tun wird. An dieser Stelle sind jedoch bereits zwei Schlussfolgerungen möglich:
- Die verbreitete Meinung, dass Marx im „Kapital“ eine nüchterne Analyse des Kapitalismus vorlegt, die nur in der Motivation des Analytikers einen moralischen Antrieb hat (nämlich: Mitleid mit dem verelendeten Proletariat), ist nicht haltbar. Marx behauptet zwar, dass er den Kapitalisten nicht moralisch kritisieren wolle, weil der Kapitalist in den Gesetzen des Kapitalismus selbst nur ein Getriebener sei, doch im „Kapital“ ist ständig von „Bereicherung“ und „Ausbeutung“ die Rede, womit eindeutig moralische Wertungen verbunden sind. Gravierender ist aber, dass das logische Fundament dieser Wertungen die bloße Dezision ist, dass nur die Arbeiter Werte schaffen, und sich damit der Humanismus von Marx als Ideologie entpuppt.
- An dem humanistischen Motiv von Marx’ Kapitalismuskritik lässt einen auch seine Beurteilung des Kapitalismus zweifeln. Marx sah in der Verelendung des Proletariats nicht ein Übel, dass es zu beseitigen gilt, sondern eine historische Notwendigkeit. Das zeigt sich besonders deutlich an einer Stelle, an der er Ricardo gegen die verbreitete Kritik in Schutz nimmt, dieser sei zynisch gewesen, weil der Kapitalismus für ihn notwendig mit Menschenopfern verbunden sei:
Was andere an Ricardo kritisieren – nämlich dass er nicht die Frage nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der kapitalistischen Ordnung stellt – hält Marx für Ricardos große Stärke: Der Kapitalismus muss notwendig Menschenopfer auf dem Altar des Fortschritts erbringen, denn nur so schreitet die Geschichte voran und führt – nach der blutigen Phase der Diktatur des Proletariats – zum Endziel der radikalen Gleichheit und kollektiven Glückseligkeit. In dieser Einschätzung der „notwendigen“ Opfer im Kapitalismus wird deutlich, dass für Gerechtigkeit in Marx’ Kapitalismuskritik gar kein Raum ist – zumindest dann nicht, wenn man Gerechtigkeit mit individueller Verantwortung verbindet. Die Frage nach Gerechtigkeit stellt sich nur dann, wenn einzelne Personen für ihr Handeln bzw. die Gestaltung der politischen und sozialen Ordnung verantwortlich sind. Bei Marx soll das gesellschaftliche Übel der Ausbeutung aber nicht durch verantwortliches Handeln überwunden werden, sondern es soll sich im Geschichtsprozess selbst vernichten – jede Form von individueller Verantwortung wird dabei explizit zurückgewiesen, so dass für Fragen der Gerechtigkeit gar kein Raum ist. – Die Entdeckung der Verantwortungslosigkeit des einzelnen für die gesellschaftliche Entwicklung ist jedoch keine spezifische Leistung von Karl Marx – er hat sie von seinem ärgsten Feind, dem Wirtschaftsliberalismus, bloß übernommen: Dort, im Wirtschaftsliberalismus, soll der Markt alles automatisch regeln, was dann bei Marx – zugegebenermaßen in anderer Form – die Geschichte erledigt.
[1] PD Dr. Hendrik Hansen, Professur für politische Theorie und Ideengeschichte, Universität Passau, Michaeligasse 13, 94032 Passau; E-Mail: hendrik.hansen@uni-passau.de.
[2] So z. B. Michael Heinrich: Die Finanzkrise nach Karl Marx. Die Spielregeln, nicht die Spieler. In: taz vom 14.1.2009 (http://www.taz.de/1/debatte/theorie/artikel/1/die-spielregeln-nicht-die-spieler/, 21.5.2010).
[3] Zitiert nach Sabine Nuss, Anne Steckner und Ingo Stützle: Die Marx-Bubble. Vom Medienhype des Longsellers in Zeiten der Finanzkrise. In: ak – Zeitschrift für linke debatte und praxis, Nr. 533 vom 21.11.2008.
[4] Reinhard Marx: Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen. München: Pattloch, 2008, S. 16.
[5] Stéphane Courtois (Hrsg.): Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror, Bd. 1. München: Piper, 1998.
[6] Karl Marx: Das Kapital, Bd. I, MEW Bd. 23, S. 49.
[7] Siehe zum folgenden: Karl Marx: Das Kapital, Bd. 3, MEW Bd. 25, S. 221-241.
[8] Kapital I, S. 209.
[9] Kapital III, S. 242-250.
[10] Kapital I, MEW Bd. 23, S. 12; an dieser Stelle im Vorwort zum ersten Band des „Kapitals“ geht es Marx um die Gesetze im allgemeinen, die den Kapitalismus und die menschliche Geschichte bestimmen.
[11] Vgl. ebd., S. 790f.
[12] Vgl. dazu z. B. die Hauptgutachten der Monopolkommission: http://www.monopolkommission.de.
[13] MEW 23, S. 59.
[14] Vgl. Kapital I, S. 791.
[15] „Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“ (Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, in: MEW Bd. 19, S. 28; vgl. auch seine Beschreibung des „rohen Kommunismus“ in den „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“, Hamburg: Meiner-Verlag, S. 83-86.)
[16] Carl Schmitt: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin: Duncker & Humblot 20109, S. 75.
Der Vortrag von Frau Prof. Zehnpfennig liegt nicht schriftlich vor. Ihre Deutung der Position von Marx wird in folgendem Beitrag für die Zeitung "Die Welt" deutlich (veröffentlicht am 19.8.2009). Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Position von Karl Marx siehe die Einleitung von Prof. Zehnpfennig zu den von ihr herausgegebenen "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" von Marx (Hamburg: Meiner Verlag, 2008).
Stalin hat den Marxismus nicht allein ruiniert
aus: www.welt.de
Es ist nach wie vor eine weitverbreitete Meinung, dass die Übel, die die sozialistischen beziehungsweise kommunistischen Staaten über die Menschen gebracht haben, auf einer Verfälschung der marxschen Gedanken beruhen. Stalin sei der Vater aller Gräuel. Nur weil Machtbesessenheit und Skrupellosigkeit sich der marxschen Theorie bemächtigt hätten, sei diese noch lange nicht desavouiert. Ihre wahre Verwirklichung stehe vielmehr noch aus – ein Grund, sich gerade in Zeiten eines krisengeschüttelten Kapitalismus auf Marx zurückzubesinnen und aus seiner Kapitalismuskritik die Konsequenzen zu ziehen, die er selbst vorsah, bevor seine Adepten seiner Theorie Gewalt antun konnten.
Angesichts solch zyklischer Wiederkehr des Versuchs, Marx zu reaktivieren, angesichts der Attraktivität, die die marxsche Theorie noch immer gerade auf wohlmeinende und um Gerechtigkeit besorgte Menschen ausübt, sollte man noch einmal genauer hinsehen: Darf man Marx wirklich von den Folgen, die andere aus seiner Theorie ableiteten, entlasten? Kam das Übel tatsächlich erst mit Stalin in die Welt, wie die stete Rede vom „Stalinismus“ als Inbegriff kommunistischer Willkürherrschaft suggeriert? Was wollte Marx eigentlich, und sollte man das wollen?
Schon der Blick von außen nährt den Zweifel, ob Theorie und Praxis des Kommunismus wirklich so wenig miteinander zu tun haben, wie immer wieder behauptet. Noch jedes sozialistische oder kommunistische System hat sich auf Marx berufen, und noch jedes dieser Systeme war ein Unrechtsregime, in dem Menschen bespitzelt, unterdrückt, ermordet wurden. Selbst in „gemäßigten“ sozialistischen Systemen waren die Menschen Opfer eines verbrecherischen Zugriffs seitens der Partei.
So verschieden die Versuche der Umsetzung von Marxens Theorie waren, so einheitlich war das Ergebnis: Eine Partei riss alle Macht an sich, verkündete das große Ziel, das allerdings erst in ferner Zukunft zu realisieren war, und setzte in der immer wieder verlängerten Zwischenzeit bedenkenlos alle möglichen Gewaltmittel ein, um die Menschen für das anvisierte Ziel zu konditionieren. Die schätzungsweise 80 bis 100 Millionen Toten, die dies Experiment gefordert hat, sind ein starkes Indiz dafür, dass es nicht an der fehlenden Verwirklichung, sondern an der fehlenden Verwirklichbarkeit der Theorie lag, wenn die Umsetzung des Ideals immer wieder scheiterte, zumal sich trotz der Verschiedenheit der Ausgangsbedingungen, der Kontinente, auf denen das Experiment stattfand, und der Kulturen, in die es implantiert wurde, stets wieder dieselben Strukturen herausbildeten.
Zugegebenermaßen ist das aber nicht mehr als ein Indiz. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich allesamt, Kubaner wie Chinesen, Deutsche wie Russen, Kambodschaner wie Albaner, zu Unrecht auf Marx beriefen, kann die Praxis allein die Untauglichkeit der Theorie nicht belegen. Es bedarf schon eines prüfenden Blicks auf die Theorie selbst. Wie begründet Marx also seine Hoffnung in die kommunistische Gesellschaft?
"Verderblicher Kapitalismus"
Verblüffenderweise sind die Ausführungen über die dermaleinst zu erwartende neue Gesellschaft im Werk recht dünn gesät. Das, wofür man streitet, bleibt recht vage; dafür weiß man umso genauer, wogegen man kämpft. Der Analyse des Kapitalismus und seiner verderblichen Vorgeschichte wird ungleich mehr Raum zugestanden als der Schilderung dessen, worauf der ganze Kampf zielt.
Will man dennoch ein wenig mehr darüber erfahren, was den Menschen am Ende des entbehrungsreichen Weges erwartet, so empfiehlt sich ein Blick in die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“. Zwar wurde diese frühe Schrift oft als unreifes Jugendwerk abgetan und die in ihr enthaltene Schilderung der ersten Phase des Kommunismus als Marxens Kritik an konkurrierenden Kommunismusvorstellungen uminterpretiert. Doch beides erscheint nicht stichhaltig. Denn hier zeigt sich, wie in Marxens Denken englische Nationalökonomie, deutscher Idealismus und französischer Frühsozialismus zur Synthese gelangten, eine Synthese, die auch die Grundlage aller weiteren Schriften blieb. Und die beschriebenen Phasen des Kommunismus, einschließlich der sehr unschönen ersten, sind unabdingbare Stufen des Weges, wenn man der Logik der marxschen Argumentation folgt.
Diese verläuft vereinfacht folgendermaßen: Dass die Geschichte einen so verhängnisvollen Gang nehmen und in entmenschlichte Ausbeutungsverhältnisse münden konnte, liegt an einer ursprünglichen Verkehrung. Aus dem Gemeineigentum wurde Privateigentum, das heißt, man schloss die Nichtbesitzenden vom Genuss des Eigentums aus. Doch schlimmer noch: Man nötigte sie, ihren Lebensunterhalt durch Veräußerung ihrer Arbeitskraft zu verdienen, gab ihnen aber nur einen Teil dessen, was sie erwirtschaftet hatten, in Form des Lohnes zurück. Alles, was der Mensch in Jahrtausenden an zivilisatorischen Errungenschaften hervorbrachte, diente letztlich dazu, die Eigentumsverhältnisse zu zementieren. Religion, Staat, Recht, Familie, Moral, Wissenschaft, all diese Überbauprodukte standen und stehen im Dienst des Verwertungsinteresses der Besitzenden. Insofern ist es konsequent, dass dies alles im Kommunismus abgeschafft werden muss.
Konsequent materialistisch gedacht
Wie gelangt man nun aber zum Kommunismus? So wie die Eigentumsverhältnisse die Menschen ins Unglück gestürzt haben, werden sie sie auch wieder erlösen. Es ist nicht menschlicher Willensentschluss, sondern eine geschichtliche Notwendigkeit, welche die entscheidende Wende herbeiführen wird. Das bedeutet: Die künftige Menschlichkeit, von der der Kommunismus erfüllt sein soll, verdankt sich nicht dem Menschen, sondern dem Prozess, der sich durch ihn hindurch vollzieht. Das ist konsequent materialistisch gedacht.
„Die Aufhebung der Selbstentfremdung macht denselben Weg wie die Selbstentfremdung“, das heißt, es gibt keinen direkten Weg in das Paradies. Erst müssen die alten Bewusstseinsformen verschwinden, die den ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen immer hinterherhinken. Deshalb ist die erste Phase des Kommunismus auch der „rohe Kommunismus“. Hier herrschen „Neid und Nivellierungssucht“, die „Persönlichkeit“ des Menschen wird „überall negiert“, und was nicht von allen besessen werden kann, wird zerstört.
Habsucht verwandelt sich in Neid
Durch die gewaltsame Aufhebung des Privateigentums ist die Habsucht also nicht automatisch verschwunden. Vielmehr wollen ihr jetzt all die nachgehen, die sie bisher noch nicht ausleben konnten, das heißt die vormals Entrechteten und Besitzlosen. Da diese im Kommunismus aber nichts für sich haben dürfen, sorgen sie zumindest dafür, dass niemand mehr haben kann als sie – die Habsucht verwandelt sich in Neid. Dieser wütet auch gegen solch persönliche Besitztümer wie das „Talent“, das es zu zerstören gilt. Marx malt nicht weiter aus, wie sich das in praxi auswirken mag. Man kann es sich aber vorstellen.
Wie soll nun aus diesem Zustand des losgelassenen Hasses auf alles, was herausragt, der Triebhaftigkeit und Gewalttätigkeit die wahrhaft menschliche Gesellschaft erwachsen? Es bleibt nur eine Antwort: durch die Selbstdestruktion der Habsucht. Sie wird allen ermöglicht und damit faktisch niemandem mehr, weil das, was wenige besessen haben, nicht von allen besessen werden kann. Die Habsucht wird gegenstandslos, weil es nichts zu haben gibt, zumal der Furor der Vernichtung das Leben auf seine primitivste Form zurückwerfen wird, wie Marx konzediert.
Doch dann, so Marxens Prophezeiung, nach diesem Purgatorium, wird das Leben aufblühen, ist doch nicht nur das Privateigentum, sondern irgendwann sogar die Erinnerung daran getilgt. Einen Gott, in dem er seine eigenen Kräfte vergegenständlicht, braucht der Mensch nun nicht mehr, ebenso wenig wie den Staat, das Recht, die Moral. Er weiß sich als Herr seiner Erzeugnisse, ja sogar als Schöpfer der Natur. So weit Marxens Ausführungen. Die Frage ist, ob das, was Marx will, auf andere Weise vorstellbar ist.
Wenn jedes Für-sich-haben-Wollen als Perversion denunziert wird, dann ist Individualität im herkömmlichen Sinne schlicht nicht mehr zulässig. Alles, was Menschen voneinander unterscheidet, ist das ihnen Eigene; wie sollte im Kommunismus der als böse verteufelte Wettbewerb aufhören, wenn Menschen weiterhin ihre Eigenheiten pflegen dürfen? Sie dazu anzuhalten, ihre Talente beispielsweise in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, würde Marxens Intention verkehren. Die neue Gesellschaft soll sich doch gerade dadurch auszeichnen, dass es individueller Entscheidung oder Moral nicht mehr bedarf! Die richtigen Verhältnisse produzieren mit Notwendigkeit das richtige Bewusstsein. Das ist erreicht, wenn man gar nichts mehr will, was sich nicht in Gemeinschaftskategorien übersetzen lässt.
Bei der marxschen Theorie eine Blütenlese vorzunehmen und die erfreulichen Teile herauszupflücken, wäre strikt gegen die marxsche Intention. Wer aber in der marxschen Logik bleiben will, wird wohl kaum ein System realisieren können, das sich gänzlich von den bisherigen Umsetzungsversuchen unterscheidet. Solange das Bewusstsein noch mit den Malen der alten Gesellschaft behaftet, der Staat nicht abgestorben ist, muss der Staat noch einmal die Zähne zeigen; zermalmt wird, wer immer noch falsch denkt. Stalin war es nicht allein. Eine Ideologie, die es den Verhältnissen überlassen will, den Menschen zu befreien, kann schwerlich die wahre Menschlichkeit für sich reklamieren – es sei denn die des „neuen Menschen“, der gar nicht mehr will, was er nicht wollen soll.
Das Jahr 1989 war auch das Jahr eines streng geheimen wirtschaftlichen Offenbarungseides im Politbüro, dem innersten Machtzirkel der SED. Selbst die Zinsen für Devisenkredite konnten aus den Exporterlösen nicht mehr erwirtschaftet werden. Damit stand die DDR so nah am Staatsbankrott, dass Teile der Führungselite sogar eine Konföderation mit dem "Klassenfeind", der Bundesrepublik als Notlösung diskutierten...
Wie war es wirklich bestellt um die Werte in diesem untergegangenen Land? Was war das Kennzeichen der DDR: Geborgenheit oder erdrückende Herrschaftspräsenz, gesicherter Arbeitsplatz oder organisierte Mangelwirtschaft? War die von Erich Honecker 1971 verkündete, von vielen hoffnungsvoll mitgetragene "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik" bereits der Anfang vom Ende? Was war der tatsächliche Preis für den als Errungenschaft gefeierten subventionierten Grundbedarf? Und vor allem: Wie sah er aus, der normale Alltag einfacher DDR-Bürger jenseits trockener Fakten, neuer Legenden und subjektivem Erinnern? Diesen und anderen aktuellen Fragen zum Thema DDR geht Udo Scheer nach und stellt sich der Diskussion.
zu Details des Referats s.a. Zusammenfassung der Referate
Die Debatte um einen dritten Weg hat sich historisch erledigt. Sie ist mit dem Epochenwechsel 89/90 in Mittel- und Osteuropa durch die Etablierung von Demokratien nach westlichem Vorbild entschieden worden.
Dieser Umstand darf jedoch mit den Markideologien, die sich in den westlichen Demokratien in den 80-ger und 90-ger Jahren durchgesetzt hatten, nicht verwechselt werden.
Daher sind weitere Debatten um die Zukunft der sozialen Demokratie sowie unserer Wirtschafts- und Finanzordnung, notwendig und sinnvoll. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, was die Konzepte eines Dritten Weges leisten könnten und anbieten.
Was wäre ein Dritter Weg (historisch und aktuell)?
- Freiwirtschaft (Ohne Geld und Bodenzins)
- Dreigliederung des sozialen Organismus; (Steiner)
- Austromarxismus
- Sozialistische Marktwirtschaft
- Dritter Weg (Anthony Giddens)
- Arbeitsverhältnisse in der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland
- Direkte, unmittelbare Volksherrschaft
Die Tätigkeit der Opposition der DDR war von der Diskussion um Alternativen zum Sozialismus, aber auch zum Parteienstaat der alten Bundesrepublik überschattet. Durchgesetzt haben sich die prowestlichen Konzepte, insbesondere im Zusammenhang mit der Sozialdemokratie.
Die Suche nach einer Verbesserung der Demokratie, der sozialen Teilhabe und der wirtschaftlichen Lage der großen Masse der Bevölkerung wird immer auch die vorhandenen poltischen und rechtlichen Strukturen in den westlichen Demokratien in Frage zu stellen haben.
Rechtsstaat, Grundrechte, Privateigentum und Wettbewerb sollten um der Freiheit und Demokratie sowie einer leistungsfähigen Volkswirtschaft nicht in Frage gestellt werden. Insofern brauchen wir keinen dritten Weg.
Ungelöste Fragen unserer Zeit sind z.B. die hohe Arbeitslosigkeit, das Auseinanderdriften von Arm und Reich, der ungeregelte internationale Finanzverkehr. Insofern brauchen wir tiefgreifende Reformen und eines politischen Diskurses, der auch radikale Lösungsansätze nicht tabuisiert.
Die sozialen Missstände unserer Zeit führen zu Populismus, Nostalgie und der Rückkehr zu gescheiterten politischen Konzepten. Sowohl der Rechtsextremismus, als auch die Ostalgie nähren sich von Unkenntnis, Unbildung, Rückständigkeit und sozialer Ungerechtigkeit. Sie sehen in der Demokratie ihren Gegner. Die Abwehrreflexe gegenüber dem weiteren Voranschreiten der Moderne sind unser Hauptproblem.
Was können wir, was könnte die Politik in der geschilderten Situation tun?
Das Problem ist nicht, was getan werden kann, sondern was die Politik unternimmt mit der Folge, dass die SED-Diktatur in den Augen der Bevölkerung verharmlost wird. Koalitionen mit der Linkspartei sind heute an der Tagesordnung. Ihre Westausdehnung ist gelungen. Die Nomenklatura der ehemaligen DDR haben sich mit Hilfe der Blockparteien retten können. Versöhnungsdebatten stellen die Aufklärer an den Pranger statt die Täter. Die BStU soll ins Bundesarchiv überführt werden. Die Ehrenpension ist zu kurz bemessen. Die Entschädigungen greifen häufig nicht. Die alten Systemrenten der DDR sind wieder eingeführt worden. Leute wie Rosemarie Will werden Verfassungsrichter. Olberz wird Minister und Hochschulrektor. Über die DDR herrscht Unwissen. Ihr Unrechtscharakter wird in Frage gestellt. Aufklärung findet zu wenig statt.
FAZIT:
- Zu wenig Wissen
- Unklarheit beim totalitären Charakter der DDR
- Unklarheit über die Wesensgleichheit von Nazi- und SED-Diktatur
- Opfer führen ein Schattendasein, sie stehen selten im Blickpunkt der Öffentlichkeit
- Vernichtung von Überbleibseln der SED-Diktatur (Mauer, Waldheim, Cottbus, etc.)
- Keine Thematisierung des Anpassungsverhaltens, statt dessen Verklärung der Mitläufer
Dennoch kann man auch heute handeln, Stichworte:
- 5 % der Kulturetats für Aufklärung und Aufarbeitung einsetzen, Unterstützung bei Wirtschaft organisieren
- mehr Aufarbeitung, Preise für bedeutsame Aufarbeitungsinitiativen, Symbole schaffen
- Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundesregierung, und entsprechende Landesinstitutionen sollten Vergangenheitsaufarbeitung wirksamer in Mittelpunkt stellen
- mit provokanten Aktionen die Politik zwingen, sich zur Basis zu stellen.
- aufzeigen, wie viel schlechtes Gewissen die bisherige Vergangenheitsaufarbeitung mitbestimmt.
- mehr Aufklärung verlangen : in Schulen, Hochschulen, Medien, gegen die Verklärung der Vergangenheit
- Anpassungsprozesse beschreiben, Gegenüberstellen von Anpassungsverhalten und Zivilcourage
- Zivilcourage belohnen, frei leben, unabhängig sein
- Notwendigkeit und Möglichkeit von selbstbestimmten Leben thematisieren
- Konsequenzen aus der Diktatur ziehen, Auflehnung gegen Unrecht befördern, Unrecht thematisieren, Freiheitstradition stärken
- Unbewältigtes Unrecht aus DDR-Zeiten ins Licht der Öffentlichkeit rücken: Zwangsausgesiedelte, Zersetzungsopfer, Systemrenten versus Opferrenten
- sich an öffentlichen Debatten beteiligen, Debatten anstoßen, provozieren
- politische Moral diskutieren, Anstand einfordern
- Parallelen zur Nazidiktatur thematisieren, auf totalitäre Vergangenheit hinweisen, totalitäres Denken und Handeln thematisieren
- Opfersituation verbessern, Rehabilitation für die Opfer, Opfer in Mittelpunkt der Politik stellen, Soziale Lage der Opfer skandalisieren, Ausweitung der Opferpension
- Opfergespräche moderieren (Opfer aller Art, Nazi, SED, Kommunismus, Fundamentalismus, Menschenrechtsverletzungen)
- Stätten und Symbole des kommunistischen Terrors benennen: Internierungslager, Bautzen, Hohenschönhausen, Mauer, ZK, MfS, Polizei, Grenztruppen, Prag 68, 17.Juni 53, Ungarn 56, Polen 56, 81, KGB, Securitate
- Kartographie des Kommunistischen Terrors betreiben, Gedenkorte pflegen, Gedenkstättenarbeit öffentlichkeitswirksam betreiben
- Missstand der Verklärung der DDR thematisieren
- Auf Zusammenhang Geschichtslügen und aktuellen Geltungsansprüchen bei der Linkspartei hinweisen
- Koalitionen mit Linkspartei thematisieren
- Personal (Rosemarie Will, Olberz) thematisieren
- Falsche Versöhnung thematisieren, auf Konsequenzen verweisen
- Liberale Politik einfordern
- Demokratie auf gleicher Augenhöhe betreiben
- Gespräche mit parallelen Initiativen Ost- und Mitteleuropas
- Entfristung der öffentlichen Überprüfungsregeln im StUG verlangen
- Aufrechterhaltung der BStU verlangen (auch in der Fläche)
Das Verhältnis der DDR-Opposition zur nationalen Frage, gleichsam ein Maßstab über ihr Verhältnis zu einem „dritten Weg“, ist ein umstrittenes Thema. Dabei geht es um die Deutung des Verständnisses der Opposition für die nationale Frage. Der Hauptwiderspruch lässt sich zusammenfassen, nach der einerseits die Opposition die Erringung der deutschen Einheit als Ziel eigenen Wirkens angesehen und anerkannt habe. Andererseits behaupten Zeithistoriker und Zeitzeugen, habe die Opposition an der Eigenständigkeit der DDR und damit an einem neuen Sozialismusexperiment - also einem dritten Weg - festgehalten. Um eine Antwort zu finden bedarf es einer zeitlichen Klärung, denn die Opposition hat sich in den unterschiedlichen Phasen der Revolution den Bedingungen angepasst. So ist sie den Forderungen, die etwa die Demonstranten auf der Straße vorgaben, nachgelaufen oder hat, ganz im Gegensatz dazu, diese Forderungen diktiert, die dann wiederum die Straße aufnahm.
Es ist grundsätzlich falsch, der Opposition nachzusagen – wie etwa von Martin Jander getan –, sie hätte sich nicht mit der deutschen Frage beschäftigt oder sie gar tabuisiert. Die Frage ist eher, wie und mit welcher Intention hat sie sich der Frage gewidmet.
Die deutsche Frage in den 1980er Jahren
Bereits 1981 und 1982 haben oppositionelle Kreise um Robert Havemann und Rainer Eppelmann die deutsche Frage behandelt. In einem Offenen Brief Havemanns an den Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Leonid Breshnew, fordert Havemann bereits 1981 den Abzug aller Besatzungstruppen und den Abschluss der Friedensverträge. „Wie wir Deutsche unsere nationale Frage dann lösen werden, muss man uns schon selbst überlassen…“.[1] Der Brief findet immerhin 200 Unterzeichner. Noch größere Resonanz mit gut 2000 Unterschriften erlebt der von Robert Havemann und Rainer Eppelmann erarbeitete „Berliner Appell“ (25.1.1982).[2] Auch er setzt eigene deutschlandpolitische Akzente, indem es heißt: „Die Siegermächte des 2. Weltkrieges müssen endlich die Friedensverträge mit beiden deutschen Staaten schließen, wie es im Potsdamer Abkommen von 1945 beschlossen worden ist. Danach sollten die ehemaligen Alliierten ihre Besatzungstruppen aus Deutschland abziehen und Garantien über die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der beiden deutschen Staaten vereinbaren.“[3]
Havemann geht in einem Interview, an dem auch Eppelmann teilnimmt, sogar noch weiter. So verkündet er das Ziel der Wiedervereinigung, jenseits des Status quo der Bundesrepublik und der DDR mit einer Vorbildwirkung für Europa.[4] Auch wenn Eppelmann selbst Havemanns Aussagen später relativiert, ist der Ansatz, der Auswirkungen auf spätere deutschlandpolitische Überlegungen der oppositionellen Gruppierungen hat, beachtlich.
Nimmt man diese und andere Äußerungen namhafter Oppositioneller zusammen, lässt sich seit Beginn der 1980 Jahre die Beschäftigung der Opposition mit der nationalen Frage nachweisen. Dabei spielt 1987, das Jahr des Honecker-Besuches in Bonn, eine Schlüsselrolle. Diese Hinwendung speist sich aus drei Quellen:
- einer ideellen, dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit als Nation, dem, trotz aller Beeinflussung der SED-Ideologie, Nichtaufgeben kollektiver nationaler Identifikation. Eine Identifikation, die auf Grund politischer, ökonomischer, ökologischer und sozialer Zwänge zunimmt.
- einer außenpolitischen, die eine „nationale Antwort“ auf die als Bedrohung empfundenen Besatzungsmächte und deren Aufrüstung auf deutschem Boden fordert.
- einer innenpolitischen, die durch den Wunsch nach grundlegenden Menschenrechten, der Freizügigkeit, massenhaftem und zunehmendem Ausreisebegehren, aber auch der Beschäftigung mit der Staatsbürgerschaftsfrage gekennzeichnet ist.
Für die ideelle Komponente der Identifikation stehen die Aussagen von Ludwig Drees (Stendaler Psychologe, zeitweilig Mitglied im Fortsetzungsausschuss „Frieden konkret“) in einer Samisdat-Zeitschrift: „Die Verleugnung betrifft auch Deutschland. Die Grenze geht durch Deutschland und durch uns […] Wir sind Deutschland und sind es nicht. Die Reisenden und Emigranten gehen von einem Staat in den anderen, aber sie gehen auch von Deutschland nach Deutschland. Im Prozess der Abgrenzung wurde Deutschland tabuisiert. Im Bewusstsein der Menschen gibt es aber weiterhin das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ost und West, trotz Anerkennung der doppelten Staatsbildung. Niemand erlebt Westdeutsche als Ausländer.“[5] Diese Aussagen kulminieren in der Feststellung: „im Hintergrund […] lebt eine heimliche Liebe zu Deutschland, in der Vorstellung der Zugehörigkeit zu Deutschland als Nation.“[6]
Mindestens so beachtlich sind die Aussagen des späteren Gründervaters des Demokratischen Aufbruchs, Edelbert Richter. Richter stellt „die Suche nach unserer Identität als Deutsche“ in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Gleichzeitig warnt er davor, diese allein von „unserer Sprache, unserer Kultur, unserer Heimat“ abzuleiten, da dieser „objektive Nationsbegriff“ in die Irre leiten könne. So führt er aus, dass „ein Streben nach Wiedervereinigung unter diesem Vorzeichen zwar vielleicht die Großmächte (gegen uns) zusammenbringen, insofern dem Frieden dienen; aber abgesehen davon, dass dies von den heutigen Kräfteverhältnissen her kaum möglich wäre, wäre es auch nicht wünschenswert, denn es würde eine Art Wiederkehr des Nationalsozialismus und der Anti-Hitler-Koalition bedeuten.“ Entsprechend empfiehlt Richter, der die „Sehnsucht nach der Einheit Deutschlands“ wieder wach werden sieht, „auf den objektiven Nationsbegriff der deutschen Tradition endlich ganz zu verzichten“, was einer Absage an den „bürgerlichen Nationalgedanken“ gleichkommt.[7]
Die außenpolitische Komponente des neuen nationalen Selbstverständnisses nährt sich am Widerspruch gegen die Mauer und die Blockkonfrontation. Die Parallelen zur Friedensbewegung im Westen sind deutlich. Dazu zählen für die DDR-Opposition:
Erstens: die Einsicht in das Versagen einer Friedenssicherung durch die Großmächte NATO und Warschauer Pakt und die bestehende atomare Gefahr zu Lasten beider Teile Deutschlands
Zweitens: die Vorstellung, dass nur ein militärisch neutrales, wenigstens unabhängig von den Blöcken agierendes Deutschland ein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen kann
Drittens: die Hoffnung, dass die Beseitigung, zumindest Reformierung/Liberalisierung der SED-Diktatur und seines menschenverachtenden Systems durch eine von Moskau unabhängige Innenpolitik gelingen könne
Viertens: das Vorhandensein einer zivilisations- und kulturkritischen Haltung gegenüber den USA und der westlichen Werte- und Konsumwelt
So verweist Ludwig Mehlhorn (Demokratie jetzt) in seinem, auf den 27.8.1986 datierten Brief an die Bischöfe Kruse und Forck darauf, dass die „Anti-Hitler-Koalition die Spaltung Europas in zwei hochgerüstete Militär- und Machtblöcke samt der Teilung Deutschlands und Berlins nicht unbedingt angelegt (habe).“[8]
Für Mehlhorn ergibt sich daraus die Möglichkeit, an der „Perspektive der Einheit“ festzuhalten. „Diese »Einheit« braucht man sich nicht im nationalstaatlichen Sinne vorzustellen. Aber über die Stufen Entmilitarisierung und vertraglich gesicherte Neutralität könnte sie eines Tages auf friedlichem Wege erreicht werden, ohne Bedrohungsängste bei unseren Nachbarvölkern hervorzurufen.“[9]
Gegenüber einer Delegation der CDU/CSU-Fraktion bei der Opposition (Eppelmann, Poppe) halten die Vertreter der Opposition „eine Lösung der deutschen Frage für vorstellbar, wenn sie Bestandteil eines gesamteuropäischen Vertragssystems wäre“.[10] Auch hier stehen Überlegungen im Mittelpunkt, durch Auflösung der Blöcke oder „neutralisierte Zonen“ Bewegung in die deutschlandpolitische Debatte zu bringen. Angesichts des Einflusses der Opposition ist dies geradezu ein kühnes Unterfangen.
Die innenpolitische Komponente der nationalen Hinwendung lässt sich im Spannungsfeld von Ausreisebegehren und Auseinandersetzung um die DDR-Staatsbürgerschaft verorten. Hintergrund sind hier die zunehmenden politischen, ökonomischen und sozialen Zwänge, eine restriktive Reiseregelung, die Verweigerung der SED-Führung gegenüber jeglichen Reformen und eine um sich greifende Hoffnungslosigkeit, die ab Mitte der 1980er Jahre einen dramatischen Anstieg der Ausreisebegehren bewirken (1986 - 78 000; 1987 - 105 000; 1988 -113 500; bis zum 30.6. 1989 - 125 400).[11]
Diese Entwicklungen werden in den Oppositionsgruppen höchst unterschiedlich aufgegriffen. Die Antworten reichen von einer Abweisung des Ausreisebegehrens - schließlich erschweren die Ausreiser jede organisierte oppositionelle Arbeit - bis hin zu organisatorischen Zusammenschlüssen, um Ausreisern Rechtsbeistand zu sichern. Entsprechend unterschiedlich ist auch die Haltung zur Staatsbürgerschaftsfrage.
Deutsche Frage und dritter Weg am Vorabend der Revolution
In der vorrevolutionären Phase der Revolution, die am 7. Mai 1989 mit der gefälschten Kommunalwahl beginnt, werden die Grundlagen für die Infragestellung der DDR und damit die Lösung der deutschen Frage gelegt. Dazu zählen neben den monatlichen Demonstrationen auf dem Alexanderplatz mit wenigen Teilnehmern und den Friedensgebeten in Leipzig vor allem der weitere Anstieg der Ausreisezahlen und die Botschaftsbesetzungen in Prag, Budapest und Warschau. Beachtlich sind aber vor allem die Initiativen zur Gründung neuer kirchenunabhängiger oppositioneller Vereinigungen. Die Forderungen nach Freiheit öffnen nun bewusst oder unbewusst die Schleusen zum Einheitsbegehren.
Bereits im Sommer 1989 kursieren verschiedene Papiere, wie der Samisdattext Edelbert Richters (später Demokratischer Aufbruch) „Zweierlei Land – eine Lektion – Konsequenzen aus der deutschen Misere“[12], in dem der Autor die These von einer gesamtdeutschen Blockfreiheit und eigenen sozialethischen Vorstellungen einer „deutschen Mittlerrolle“ wiederholt. Die Teilung könne so überwunden werden und in Form einer Konföderation Gestalt gewinnen. Richter selbst glaubt dabei an eine Vereinigung von sozialistischen und liberalen Ideen, eine Versöhnung von Liberalismus und Sozialismus.
Auch Konrad Weiß (später Demokratie jetzt) nimmt im Sommer 1989 die Argumentation auf. In einem in der „Zeit“ erscheinenden Beitrag unter der Überschrift „Nachdenken über deutsche Einheit“ schreibt Weiß unmissverständlich: „Ich kann und ich mag mich nicht abfinden, daß es Deutschland für alle Zeit doppelt geben muß.“ Weiß begründet seine Einstellung u.a. mit der Annahme, dass „die deutsche Einheit Ideologien und Machtinteressen geopfert wurde“, weshalb er seine Forderung unterstreicht: „Ich will, daß meine Enkelkinder einmal in einem Deutschland ohne Mauer leben.“[13]
Günter Nooke (Demokratischer Aufbruch) pflichtet dieser Ansicht am 17. Juni 1989 zu: „Die Zukunft der Deutschen sollte nicht nur mit den Namen der BRD und DDR gedacht werden. Dabei sollte keineswegs das stabilisierende Moment aus der Existenz von zwei deutschen Staaten in Mitteleuropa für den Frieden in den letzten Jahrzehnten in Abrede gestellt werden. Aber in historischen Dimensionen erscheint das absurd.“[14]
Ein Bekenntnis zu Deutschland ist auch der Text eines Essays vom Frühjahr 1989, den ich an Martin Walser schickte. Hier heißt es: „Ich bin ein Deutscher. Ich komme daran nicht vorbei, so wenig wie an mir selbst. So wenig wie an meiner und der Geschichte meiner Väter. Ich bekenne mich zu diesem Deutschland, denn ich bin ein Teil dieses Deutschlands.“[15] Die Liste der Meinungsäußerungen verschiedener Akteure, die eben genau in dieser Richtung dachten, ließe sich noch beliebig fortsetzen.
Deutsche Frage und dritter weg in der demokratischen Phase der Revolution
Die Zurückhaltung in der nationalen Frage zeichnet die gesamte demokratische Phase (7. Oktober – 9. November 1989) aus. Zwar finden sich um den 7. Oktober vor allem im Süden zahlreiche Beispiele, bei denen von Demonstranten deutsche Fahnen gehisst werden, doch eine Strategie ist dabei nicht zu erkennen. Für die Zurückhaltung gibt es zusammengefasst mehrere Ursachen:
- Die Anerkennung der Realitäten und damit des Machbaren.
- Die Anwesenheit des russischen Militärs mit einer unklaren Haltung.
- Die Angst der Revolutionäre, die DDR offensiv in Frage zu stellen.
- Rücksicht auf die SED-Mitglieder, die für eine Veränderung des Systems eine vermeintliche Schlüsselposition einnehmen.
- Der Wunsch (eines Teils der Oppositionellen) in der DDR ein alternatives demokratisches Modell jenseits des westlichen Musters zu schaffen.
Die Aufrufe der Gruppen sind deutschlandpolitisch zurückhaltend, ja geradezu gemäßigt, was taktisch gerechtfertigt ist. Nur so erklärt sich der deutschlandpolitische Schritt zurück gegenüber manch früheren Äußerung. Diese Taktik, die zuweilen auch der Überzeugung entspricht, sichert gleichsam die Handlungsfähigkeit der Opposition.
Trotz der Zurückhaltung der oppositionellen Gruppen in der deutschen Frage beginnt bereits Anfang Oktober ein erstes deutschlandpolitisches Umdenken. Die neu gegründeten Initiativen, Vereinigungen oder Parteien passen sich trotz der Beteuerungen für die Zweistaatlichkeit den veränderten Rahmenbedingungen an. So wird mit der Konstituierung der Sozialdemokratischen Partei (SDP) am 7. Oktober 1989 zwar erneut der Standpunkt wiederholt, der die „Anerkennung der Zweistaatlichkeit Deutschlands als Folge der schuldhaften Vergangenheit“ fordert, aber gleichzeitig werden „mögliche Veränderungen im Rahmen einer europäischen Friedensordnung […] nicht ausgeschlossen.“ Letzteres wird dann noch einmal mit dem Hinweis unterstrichen, dass es „besondere Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland aufgrund der gemeinsamen Nation“ gibt.[16] Beachtlich ist zweierlei: Erstens, dass eine Veränderung des Status quo nicht ausgeschlossen wird; zweitens, das Beharren auf der Theorie der „gemeinsamen Nation“, von der sich die DDR-Führung keineswegs offiziell verabschiedet hat. Weiß man um die Diskussionen in der Vorbereitungsgruppe der SDP, wird dieses Bild noch deutlicher.
Der Demokratische Aufbruch beschäftigt sich auf seiner konstituierenden Sitzung am 29. Oktober 1989 ebenfalls mit der „Zweistaatlichkeit“, allerdings fordert er nicht wie die SDP die „Anerkennung der Zweistaatlichkeit“, sondern betont deutlich abgeschwächter und weniger verbindlich: „Wir gehen von der Zweistaatlichkeit aus.“ Zwar ist die Formulierung verhältnismäßig vieldeutig, doch zeigt sie schon Änderungen und damit einige Bewegung gegenüber der „Programmatischen Erklärung“ vom 2. Oktober 1989. Auf der konstituierenden Sitzung des Demokratischen Aufbruchs am 29. Oktober werden entsprechende Forderungen, wie die nach einer möglichen Konföderation, laut. Beim DA ist es vor allem Richter, der seinen Einfluss geltend macht und bereits im September 1989 seinen Fahrplan festlegt. In seinem Text „Perspektiven für unser Land“, der vor allem in Thüringen und Berlin Verbreitung findet, heißt es: „Indem wir Differenzen innerhalb der DDR-Gesellschaft betonen, suchen wir sie aus ihrer Provinzialität und äußeren Isolierung herauszuholen und zu öffnen für die Einheit Deutschlands, Europas und der Welt.“ Dabei ist für Richter auch jetzt die Richtung klar: „Wir sehen die deutsche Identität zunächst in einem zwischen West und Ost vermittelnden, freiheitlichen Sozialismus.“[17] Richter steht damit für einen dritten Weg, aber nicht einen DDR-dritten Weg, sondern einen gesamtdeutschen dritten Weg.
Die Vereinigung Demokratie jetzt, die bereits in ihren „Thesen für eine demokratische Umgestaltung in der DDR“ vom 12. September 1989 die Forderung erhebt, „beide deutschen Staaten sollten sich um der Einheit willen aufeinander zu reformieren“[18], bringt nach dem 7. Oktober noch eine Reihe von Papieren in Umlauf, die die deutsche Frage berühren.
Auf der größten Revolutionskundgebung allerdings scheint die deutsche Frage gar keine Rolle zu spielen. Am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz taucht auf keinem der Plakate die Forderung nach der Beschäftigung oder gar Lösung der deutschen Frage, geschweige denn nach der Wiedervereinigung auf. Letzteres gefällt vor allem Bärbel Bohley: „Mit das Beeindruckendste am vergangenen Samstag war, dass da nichts aufkam von wegen Wiedervereinigung“.[19]
Dennoch rollt die Lawine, die auch einige der Oppositionellen der ersten Stunde begraben wird, denn der Zusammenhang zwischen demokratischen Forderungen und Freiheit einerseits und Einheitswünschen andererseits ist und bleibt zwingend. Deutlich wird dies einige Tage vorher in Jena.
Dort versammeln sich bereits am 2. November 1989 auf dem Jenaer Markt cirka 1500 Menschen, aus deren Mitte „mehrmals die Nationalhymne, Strophe 1“ ertönt.[20] Dies ist zwar die Hymne der DDR, doch heißt es eben in dieser seit Jahrzehnten untersagten Strophe: „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland.“ Angestimmt wird die Hymne von Albrecht Schröter, einem Jenaer Aktivisten des Demokratischen Aufbruchs, am Ende seiner Rede.[21] Deutlicher kann der Wunsch nach Wiedervereinigung kaum artikuliert werden.
Dass Reformen automatisch zur Liberalisierung und damit zwangsläufig zur Gewährung „bürgerlicher Grundrechte“ führen würden, an deren Ende freie Wahlen stattfänden und damit die Existenzberechtigung der DDR auf dem Spiel stehen würde, vermutete ich in einem Aufsatz vom Oktober 1989. In diesem Aufsatz, geschrieben am 20.10.1989, urteilte ich, dass die „perspektivischen ökonomischen Probleme und die Präsenz eines übermächtigen Nachbarn“, nämlich der Bundesrepublik, den Weg ebnen, der nach meiner Auffassung über Konföderationsverhältnisse zur deutschen Einheit führen würde. „Die Europäer müssten zusehen und sich das Argument gefallen lassen, dass wer Europa will, am geeinten Deutschland nicht vorbei kann.“[22] Nach Aussage von Markus Meckel bei der kürzlich abgehaltenen Konferenz zum Thema ist ihm dieser Zusammenhang erst nach dem 9. November 1989 klar geworden.
Deutsche Frage und dritter Weg in der nationalen Phase der Revolution
Mit dem 9. November und der nationalen Phase der Revolution (bis zum 18. März 1990) eröffnen sich neue Optionen. Die DDR steht am Scheideweg zwischen der Eigenständigkeit und der Wiedervereinigung und damit Aufgabe des Status quo. Dabei kommt der sozialökonomischen Verfasstheit (Marktwirtschaft/Sozialismus) und der außenpolitischen Verankerung (Westintegration/Neutralität bzw. Mittelmachtmodell) eine besondere Bedeutung zu. Werden alle realistischen Optionen zusammengefasst, eröffnen sich eine Reihe von Perspektiven:
A. Die DDR als eigenständiger deutscher Staat
- als kommunistisches System
- als freiheitlich demokratischer Staat unter marktwirtschaftlichen Bedingungen und Vorgaben („Die kapitalistische DDR“)
- als freiheitlich demokratischer Staat unter Beibehaltung eigener (sozialistischer) ökonomischer Vorstellungen (Die DDR als Alternative – der „dritte Weg“ in der DDR)
B. Wiedervereinigung
- unter Aufgabe der außenpolitischen Kontinuität der Bundesrepublik (Der bundesrepublikanische Weg nach innen – der „dritte Weg“ nach außen)
- unter Beibehaltung (Kontinuität) der innen- und außenpolitischen Vorgaben und gesellschaftspolitischen Verfasstheit der Bundesrepublik (Der bundesrepublikanische Weg nach innen und außen – die doppelte „West-Kontinuität)
- unter Aufgabe der innen- und außenpolitischen Kontinuität der Bundesrepublik (Der „dritte Weg“ nach innen und außen – die doppelte „West-Diskontinuität)
Nur drei Perspektiven sind realistisch: eine in der Selbständigkeit, zwei in der Vereinigung, wobei bei näherer Betrachtung allein mit der Vereinigung realistische Umsetzungsmöglichkeiten gegeben sind. Höhepunkt der Bemühungen um einen dritten Weg ist der „Aufruf für unser Land“ vom 26. November 1989, den, angeführt von namhaften Oppositionellen wie Konrad Weiß, Friedrich Schorlemmer und Ulrike Poppe, vorgestellt von Stefan Heym und Christa Wolf, innerhalb weniger Wochen eine halbe Million Menschen[23] unterschreiben. Der „dritte Weg“ als Mittelweg zwischen „Kapitalismus und Sozialismus“ findet nicht nur bei der Bevölkerung Sympathien, sondern auch in einem Teil der Oppositionsbewegung Anhänger. Entsprechend bleibt die Hoffnung auf eine demokratische Alternative DDR gegenüber einer „kapitalistischen Vereinnahmung“ mit unsicherer „großdeutscher Zukunft.“ Trotz anhaltender Zivilisations- und Kapitalismuskritik wird der „dritte Weg“ im Laufe der Revolution von immer mehr Mitgliedern der oppositionellen Gruppierungen in seinen Zielen relativiert, dann als unrealistisch verworfen.
Deutlich gegen den „Aufruf für unser Land“ tritt der Demokratische Aufbruch und Teile des Neuen Forums (Dresden) auf, während die SDP auf eine Stellungnahme verzichtet, aber mit einem eigenen deutschlandpolitischen Programm (3. Dezember 1989) aufwartet.[24] Zum Schluss bleibt vom „dritten Weg“ nur ein Relikt einer vergangenen Zeit, gepflegt von einer politisch unbedeutenden Minderheit. Am Ende wird auch diese Idee trotz zahlreicher Nachhutgefechte (Berliner Neues Forum) zu Grabe getragen.
Neben dem „Aufruf für unser Land“ spaltet Helmut Kohls 10-Punkte Plan die bis dato weitgehend einheitlich auftretende Oppositionsbewegung. Die Folge ist eine inhaltliche Differenzierung. Zugleich eröffnet der Plan, trotz formulierter politischer Zurückhaltung, eine Wiedervereinigungsdebatte, in deren Mittelpunkt zwar der Wunsch der Opposition nach bundesrepublikanischer Kontinuität („soziale Marktwirtschaft“) steht, aber sich vorrevolutionäre Vorstellungen eines „dritten außenpolitischen Weges“ wieder finden. Entsprechend schließt eine Mehrheit der Opposition die alleinige Westintegration des vereinten Deutschlands aus. Vielmehr wird von allen oppositionellen Gründungen des Sommers und Herbstes 1989 ein Neutralitäts- oder Mittelmachtmodell (ggf. auch gesamteuropäisches Sicherheitssystem) für das vereinigte Deutschland favorisiert.
Der Weg in die „West“-Kontinuität („Der bundesrepublikanische Weg nach innen und außen“) bestimmt das politische Handeln der neuen liberalen und konservativen „Wintergründungen“ ab Januar 1990, allen voran der CSU-Schwesterpartei DSU. Auch der Demokratische Aufbruch, bislang in der Tradition national-neutralistischer Positionen, schwenkt in der „Allianz für Deutschland“ auf den neuen Kurs ein, obgleich er die Westbindung keinesfalls verinnerlicht hat.
Mit den Auseinandersetzungen um den zukünftigen Weg in die deutsche Einheit, die sich nach Artikel 23 oder 146 GG vollziehen können, zerbrechen schließlich die oppositionellen Gemeinsamkeiten der Wiedervereinigungsbefürworter. Der Bruch ist nicht nur die Folge unterschiedlicher deutschlandpolitischer Vorstellungen und Gesellschaftskonzeptionen, sondern auch Bestandteil der Neujustierung der DDR-Parteien im westdeutschen Parteienspektrum. Das Parteienmuster West wird zum Vorbild der Parteienlandschaft Ost, ein Umstand, der der Erwartungshaltung der Bevölkerung entspricht.
Der Dezember 1989 steht für den Beginn heftig geführter inneroppositioneller Auseinandersetzungen über die deutsche Frage, die alle Gruppierungen ergreift. So überlebt den inhaltlichen und personellen Wandel, der die großen Oppositionsgruppierungen (Neues Forum, Demokratischer Aufbruch) dramatisch verändert, nur ein Teil der Revolutionäre der ersten Generation. Der DA verliert auf diese Weise über Zweidrittel seines ehemaligen Führungspersonals. Auch das Neue Forum zerreibt sich in den regionalen Diskussionen. Somit ist der Weg frei für eine „2. Generation der Revolutionäre“, die im Oktober/November zu den Gruppierungen findet und sowohl die Gruppen als auch die Revolution politisiert. Sie bringt eine Reihe von Vorschlägen und Forderungen nach radikalen, geradezu revolutionären Veränderungen ein und gießt den sozialethischen und antikapitalistischen Ansatz vieler kirchlich beeinflusster Gründer in politische Forderungen, die denen breiter Bevölkerungsschichten entspricht. Dazu gehört der Wunsch nach der deutschen Wiedervereinigung. Für diese Gruppen und Personen entsteht damit eine reale Machtoption.
Diese Machtoption wird für die Opposition mit dem Bekenntnis zur Wiedervereinigung und zur gesellschaftspolitischen „West“-kontinuität des vereinigten Deutschlands deutlich.
Mit dem Anfang Dezember erscheinenden Aufruf zur Bildung einer Deutschen Nationalversammlung, später der eindeutig auf Wiedervereinigung setzenden Parteiprogrammatik (Demokratischer Aufbruch), dem Dreistufen-Plan zur nationalen Einigung (Demokratie jetzt), den Erklärungen der SDP (3. Dezember 1989) und den Aufrufen der Regionalverbände des Neuen Forum in Dresden und Leipzig stellen sich die Oppositionsgruppierungen der öffentlichen Diskussion und befruchten diese durch ihr Bekenntnis zur Wiedervereinigung. Die Forderung nach einer Deutschen Nationalversammlung (DA), noch zu einer Zeit erhoben, als die Bevölkerung eher abwartend vor den neuen Veränderungen steht, wird bereits in die darauf folgenden Demonstrationen getragen, was den unmittelbaren Einfluss oppositionellen Handelns unterstreicht.
Selbst wenn eine Reihe von Äußerungen führender Oppositioneller (Bohley) und die Aufzählung von zuweilen unrealistischen Vorbedingungen für die Einheit (Drei-Stufen-Plan von Demokratie jetzt) den Eindruck entstehen lassen, als würde die Oppositionsbewegung auf der Zweistaatlichkeit beharren, entspricht dies nur partiell und dann abnehmend der Realität. Daran ändern auch zahlreiche Vertreter vor allem des Neuen Forum, der Grünen Partei, von Demokratie jetzt und in ihrer überwiegenden Mehrheit auch der Vereinigten Linken nichts, die noch immer die Zweistaatlichkeit befürworten. Im Oppositionslager gibt es ab Februar 1990 für die Zweistaatlichkeit keine Mehrheit. Vielmehr zeigt sich die Opposition im Umgang mit der deutschen Frage ebenso gespalten wie die Bevölkerung, deren Mehrheit erst ab Dezember eine endgültige Absage an die DDR und jede Form eines „reformierten Sozialismus“ befürwortet.
Somit gibt es nach der einstimmigen Ausgangslage der oppositionellen Kräfte in der vorrevolutionären und demokratischen Phase der friedlichen Revolution spätestens mit dem Anbruch der nationalen Phase ab dem 9. November 1989 den vielstimmigen Chor der Opposition. Pluralismus und Meinungsvielfalt bestimmen fortan das politische Geschehen.
Ab Mitte Dezember 1989 ist der Zug Richtung Wiedervereinigung nicht mehr aufzuhalten. Dafür sorgen die ersten Parteiprogramme (DA, CDU), die jetzt wahr machen, was seit dem Mauerfall gilt: Wer die zukünftigen Wahlen gewinnen will, muss sich an die Spitze der Vereinigungsbewegung setzen. Ab Anfang Februar ist der Wunsch der Bevölkerung nach Wiedervereinigung erdrückend, der Weg dorthin findet mit einigen Ausnahmen keinen nennenswerten Widerstand.
Ende Februar spricht sich das Neue Forum nach heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen gegen die Eigenständigkeit der DDR aus, obgleich die Gruppierung einen großen Teil ihrer Einheitsbefürworter bereits durch Abspaltung (Forum-Parteien) sowie Aus- und Übertritte verloren hat. Bis dahin läuft die Vereinigung, die fortan unter dem Wahl-„Bündnis 90“ das Monopol auf den Namen „Bürgerbewegung“ erhebt, den Entwicklungen und Überzeugungen der Bürger hinterher und wird trotz zahlreicher Einheitsbefürworter in den eigenen Reihen (Joachim Gauck, Heiko Lietz) eher zum Bremser als zum Katalysator der nationaldemokratischen Entwicklung. Das Ziel der Vereinigung kann auch diese „Bürgerbewegung“ nicht verhindern, selbst wenn in der Volkskammer die große Mehrheit noch gegen den Einigungsvertrag stimmt.
Alle relevanten oppositionellen Gruppierungen des Herbstes, aber auch die bislang in der Forschung vernachlässigten Gruppierungen des Winters (Gründungen ab Dezember 1989) wie die Fortschrittliche Volkspartei (FVP), die Deutsche Soziale Union (DSU), die Deutsche Forum Partei (DFP) oder die Freie Demokratische Partei (F.D.P) sprachen sich bis zum Wahltermin für die deutsche Einheit aus. Gerade bei den Wintergründungen werden die Bekenntnisse zur Einheit und sozialen Marktwirtschaft zu den fast alleinigen programmatischen Aussagen verdichtet. Interessanterweise hat sich sogar die PDS, trotz parteiinterner erheblicher Vorbehalte, mit dem Aufruf: „Für Deutschland, einig Vaterland“ am 1. Februar 1990 in die Reihe der Einheitsbefürworter eingereiht. Dass dies allein aus taktischen Gesichtspunkten geschieht, liegt auf der Hand; das Ende der DDR konnte auch die PDS nicht verhindern.
Um zur Ausgangsfragestellung zurückzukommen: Wofür steht die Opposition? Die Wahrheit liegt in der Mitte und man tut der Opposition Unrecht, sie pauschal zu Reformern, die einen „dritten Weg“ und Sozialismusexperimente im Auge hatten, abzustempeln. Vielmehr gilt, sie steht geschlossen für die Freiheit (neben einigen postkommunistischen Auswüchsen) und dies ist die Voraussetzung für die Einheit. Ihre Haltung zur deutschen Einheit war viel differenzierter und muss im historischen Kontext betrachtet werden. So wird man genügend Beispiele finden, die belegen, dass sie der Einheit Deutschlands skeptisch gegenüber stand und sie sogar zu verhindern suchte. Aber es werden sich ebenso viele Beispiele finden, die belegen, dass die Opposition diese Einheit beförderte, weil sie auch von ihr gewollt wurde.
[1] Robert Havemann, Offener Brief an den Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Leonid Breshnew, in: Wolfgang Büscher, (Hrsg.), Friedensbewegung in der DDR. Texte 1978-1982, Hattingen 1982, S.178f.
[2] Erstunterzeichner sind u.a. Hans-Jochen Tschiche, Lutz Rathenow, Ralf Hirsch, Rudi Pahnke, Katja Havemann. Nach Aussagen Eppelmanns ist es Havemann, der die maßgeblichen Inhalte vorgibt.
[3] Robert Havemann, Offener Brief an den Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Leonid Breshnew, in: Büscher (Anm. 1), S. 178f.
[4] „Perspektive Entmilitarisierung und Wiedervereinigung? Interview mit Robert Havemann und Rainer Eppelmann, in: ebd. S. 192ff.
[5] Ludwig Drees, Aus der Isolation zu Wegen der Identifikation, aus: Stephan Bickhardt / Reinhard Lampe / Ludwig Mehlhorn (Hrsg.), Aufrisse. Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Ein Arbeitsbuch. (= radix-blätter) Berlin 1987, nachgedruckt in: Ilko-Sascha Kowalczuk, Freiheit und Öffentlichkeit, a.a.O., S. 435.
[6] Ebd.
[7] Edelbert Richter, Abgrenzung und nationale Identität. in: Stephan Bickhardt, Reinhard Lampe, Ludwig Mehlhorn (Hrsg.) Aufrisse. Absage ab Praxis und Prinzip der Abgrenzung. (=radix-blätter) Berlin 1987, nachgedruckt in: Kowalczuk (Anm. 5), S. 438f. Dieser Intention mit Blick auf die schuldhafte deutsche Vergangenheit entspricht auch die Auffassung von Marcus Meckel und Martin Gutzeit, obgleich sie daraus zunächst die Anerkennung des Status quo ableiten. Vgl.: Marcus Meckel / Martin Gutzeit, Opposition in der DDR, Opposition in der DDR. Zehn Jahre kirchliche Friedensarbeit – kommentierte Quellentexte, Köln 1994, S. 270.
[8] Vgl.: Ludwig Mehlhorn, Brief vom 27. August 1986, Kowalczuk (Anm. 5), S. 406.
[9] Ebd.
[10] Gerd Poppe, Dialog oder Abgrenzung? Kowalczuk (Anm. 5), S. 167.
[11] Vgl.: Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur, Alltag und Herrschaft in der DDR, Bonn 1989, S. 285.
[12] Edelbert Richter, Zweierlei Land – eine Lektion, Berlin 1989, S. 15.
[13] Konrad Weiß, Nachdenken über deutsche Einheit. Eine Stimme aus dem anderen deutschen Staat, Die Zeit, 30. Juni 1989.
[14] Vgl.: Günter Nooke, Wir trauten uns nicht, die auf der Straße liegende Macht aufzuheben, in: Eckhard Jesse (Hrsg.), Eine Revolution und ihre Folgen, Berlin 2000, S. 102.
[15] Andreas H. Apelt, Was ist uns Deutschland?, Essay, Privatarchiv Apelt.
[16] Aufruf zur Bildung einer Initiativgruppe vom 24.7.1989, in: Gerhard Rein (Hrsg.), Die Opposition in der DDR, Entwürfe für einen anderen Sozialismus, Berlin 1989, S. 93.
[17] Edelbert Richter, Perspektiven für unser Land, programmatischer Entwurf, Erfurt Ende September 1989, Archiv Neubert, zitiert nach Ehrhart Neubert, Der „Demokratische Aufbruch“, in: Eberhard Kuhrt / Hansjörg F. Buck / Gunter Holzweißig, Opposition in der DDR von den 70er Jahren bis um Zusammenbruch der SED-Herrschaft, Bd. 3, Opladen 1999, S. 545.
[18] Thesen für eine demokratische Umgestaltung in der DDR, in: Rein (Anm. 16), S. 62.
[19] Bärbel Bohley, Interview, Frankfurter Rundschau, 9. November 1989.
[20] Dr. Albrecht Schröter, Tagebuchaufzeichnungen. Privatarchiv Schröter Jena. 4.11.1989, abgedruckt in: Udo Grashoff, Der Demokratische Aufbruch, Von einer Bürgerbewegung zur Partei. Katalog der Ausstellung, Erfurt 2004, S. 38.
[21] Dr. Albrecht Schröter ist heute Oberbürgermeister von Jena.
[22] Andreas Apelt, Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Freiheit, S.4, Privatarchiv Apelt.
[23] evtl. waren es nur 230.000 Menschen (Angaben der Veranstalter; BV)
[24] Abgelehnt wird der Aufruf auch von Jens Reich, Vera Lengsfeld und Gerd Poppe.
Im ersten Vortrag „Einheitslust und Einheitsfrust“ hörten wir positive wie negative Fakten: ca. 75% der Jugendlichen in den neuen Bundesländern sehen die Wiedervereinigung positiv. Das heißt aber auch, dass ca. 25% nicht glücklich sind über die Vereinigung. 2. Eine deutliche Mehrheit der Bürger in den neuen Bundesländern entwickelt eine Art Doppel-Identität, weil sie sich einerseits als Deutsche fühlen, in Deutschland aber als ehemalige DDR-Bürger. Die Menschen aus den alten Bundesländern dagegen fühlen sich „nur“ als Deutsche. Allerdings werden die unterschiedlichen Empfindungen in Ost und West im Lauf der Jahre langsam geringer.
Im zweiten Vortrag „Was wissen Schüler in Ost und West von Ost und West?“ wurden einige erschreckende Daten aus der bekannten Schroeder-Studie vorgetragen. Sie kann man vielleicht so zusammenfassen: Alle Deutschen, speziell alle Schüler und Jugendlichen, wissen von der Geschichte Deutschlands sehr wenig, leider die aus den neuen Bundesländern noch weniger als aus den alten. Allerdings wurde auch klar, dass die Studie nur fragte; einen Lehrauftrag hatte sie nicht. Den sollten jetzt Andere übernehmen, aufgeschreckt durch die Erhebung. Darauf kommen wir noch zu sprechen.
Im nächsten Vortrag „Uns wirst Du niemals los!“ über die Langzeitfolgen nach politischer Inhaftierung in der DDR wurde deutlich, dass 70% der Gefangenen physisch misshandelt wurden, vor allem durch langes Stehen, Schlafentzug etc.; psychisch, vor allem in den Jahren nach 1955, 63%, z.B., indem man sie in Einzelhaft systematisch desorientierte oder demütigte. Klar wurde auch, dass viele Opfer Jahre brauchen, um über ihre Verletzungen überhaupt sprechen zu können, und dass es zu wenige Anlaufstellen für sie gibt, an die sie sich dann wenden können, wenn sie bereit für eine Therapie wären. Die Erhebung über 10 Jahre konnte aber keine Antwort geben auf die Fragen, wer von seiner Persönlichkeit her eher gefährdet ist, eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen, und wer eher nicht.
Danach habe ich versucht, neue Wege zu beschreiten, indem ich Referenten zu uns gebeten hatte, die sich über die Grundlagen der Marxschen Philosophie einerseits und andererseits über die der Marxschen Ideologie und deren Auswirkungen Gedanken gemacht hatten. Die Referate waren z.T. hochinteressant, sodass man sich wundern musste, weshalb die Fakten in der Öffentlichkeit so wenig zur Kenntnis genommen werden, teilweise aber auch massiv provokant und wenig erhellend, vor allem in Richtung Aufarbeitung, um die es mir und uns im Autorenkreis letztlich immer geht.
Die ersten beiden Referate – von absoluten Experten der Marxschen Schriften und seiner Ideologie – kann man zusammenfassen, dass Marx bisher leider nie hinterfragt wurde: Seine Theorie leitet sich nicht logisch ab von historischen Fakten, d.h., sie ist ein Dogma, das sich nicht an der Realität misst, sondern seine Wahrheit in sich selbst findet. Es setzt einfach voraus, dass der Kapitalismus keine Zukunft hat und die Zukunft dem Sozialismus gehöre. Er analysiert nicht Geschichte und ihre Fakten, sondern setzt eine Vision ins Zentrum seiner Gedanken. Wenn man diese Vision auf gelebte Geschichte anwenden will, z.B. auf den 30-jährigen Krieg oder den Islamismus oder irgendwelche anderen historisch bedeutsamen Geschehnisse, wird rasch klar, dass man mit Marx nichts, überhaupt nichts in der Geschichte erklären kann.
Es ist erstaunlich, wenn man die Schar seiner Jünger betrachtet – von denen sich viele als die „Intelligenz“ bezeichnen – , dass sie das Menschenbild von Marx hinnehmen: der Mensch ist kein Vernunftwesen, er hat keine Verantwortung für irgendetwas, weil die Partei alles entscheidet, es gibt in Zukunft keine Individuen und keinen Pluralismus: Das sind Gedanken, die absolut totalitär sind! Wie sich das mit dem Individualismus seiner Nachfolger vereinbaren lässt, ist nicht erklärlich.
Die folgenden Vorträge waren ein Experiment im Experiment, das leider nicht so gut gelang: War der Vortrag über die „Gleichheit“ als Ziel noch anregend, weil nachvollziehbar, dass viele „Gleichheiten“, die wir im Kopf haben, unsinnig sind, war auch nachvollziehbar, dass die Planwirtschaft a priori unsinnig und zum Scheitern verurteilt ist, waren die folgenden Thesen vielleicht doch z.T. abwegig und nicht richtungsweisend. Ich denke, dass wir hier Einiges übergehen können, weil es uns in der Diskussion um eine mögliche Aufarbeitung nicht so recht weiterbringt, die uns im Folgenden jetzt interessiert. Ein Gedanke sollte aber vielleicht doch erwähnt werden: Wir wollen ja alle Erkenntnis von Wahrheiten und geistiges Wachstum; wie das aber in einem Kommunismus funktionieren soll, in dem es keine Veränderungen mehr geben soll? Hier stocke ich schon und frage, wie sich die Neo-Kommunisten als intelligent vorkommen können.
Der letzte Vortrag in dieser Reihe über „Die DDR und ihre Strahlkraft heute“ führte wieder zurück zu den ungelösten Fragen, die noch längst nicht aufgearbeitet sind. Daraus sollen doch einige Fakten zitiert werden:
- die verdeckte Arbeitslosigkeit lag in der DDR bei ca. 30%, also höher als nach der Wiedervereinigung;
- ca. 20% der Belegschaft war immer mit Reparaturen beschäftigt, was die hohe Ineffizient der Wirtschaft erklärt;
- das „Soziale“ war in der DDR in keiner Weise besser geregelt als in den neuen Bundesrepublik; das wird schon klar, wenn man nur auf die Höhe der Renten in der DDR und heute in der BRD blickt; viele Rentner mussten damals Nebenjobs annehmen, um überleben zu können;
- in der DDR kamen weniger Arbeiterkinder zum Studium als in der alten Bundesrepublik;
- es gab einen durchgehenden Militarismus in der friedliebenden DDR; Uniformierte, vormilitärische Erziehung etc. prägten das Bild in weitem Maß;
- ca. 1000 „Schläfer“ in der BRD hatten z.T. eine Art Panzerfäuste, mit denen sie taktische Atomwaffen hätten verschießen können im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung;
- heute, 2010, meinen ca. 50% der Bevölkerung der neuen Bundesländer, dass die DDR mehr positive als negative Eigenschaften hatte;
- ebenfalls ca. 50% glauben, dass die DDR mehr positive Eigenschaften als die jetzige Bundesrepublik hatte;
- etc., etc..
Unsere Ideen, wie man diese Erkenntnisse in eine nachträgliche Aufarbeitung umsetzen könnte, kann man in 3 Punkten zusammenfassen:
- Die Aufarbeitung muss auch die SED mit einbeziehen; bisher hat man sich zu sehr auf die Stasi konzentriert. Die Partei war verantwortlich für das politische Denken, und über dieses ist bisher viel zu wenig bekannt und gesprochen geworden.
- Dieses politische Denken, seine Dogmen und seine Tabus, muss durchleuchtet werden ohne Rücksicht auf die Ikone Marx, die fast in der gesamten Bundesrepublik festzustellen ist.
- Die Aufarbeitung muss auch die Bundesrepublik erfassen, die wohlgemuten Ahnungslosen da, die 68iger etc., für die die friedliche Revolution in der DDR eine Katastrophe war, weil sie die Revolution ja im Westen herbeigesehnt und z.T. vorbereitet hatten. Hier sind vor allem viele „Intellektuelle“ angesprochen, die sich doch anders verhalten als die Intellektuellen in anderen Ländern, die längst mit ihrer Vergangenheit gebrochen haben.
Diese Art der moralischen Aufarbeitung könnte dazu führen, dass auch moralische Kriterien, Menschenrechte, Werte, eher ins Zentrum der Diskussion rücken und nicht nur wirtschaftliche Fragen.
Dabei muss in erster Linie die Jugend angesprochen werden, in den Schulen und außerhalb, z.B. durch eine bundesweite Verordnung von 3 Geschichts-Projekttagen pro Jahr, in denen die Schüler von externen Kräften – nicht durch ihre angestammten Lehrer – informiert werden, z.B. durch Zeitzeugen. An den Universitäten sollten Seminare zur Bekanntmachung von Folgen der SED-Diktatur abgehalten werden.
Auch die Medien sollten immer wieder angesprochen werden. Sie sind die wichtigsten Multiplikatoren, haben in den neuen Bundesländern aber hochprozentig immer noch ihre alte Kader-Schulung im Hinterkopf. Auch ihnen muss ja klar sein,
- dass die Bevölkerung der DDR mit der friedlichen Revolution die Wiedervereinigung erzwungen hat!
- Und: Ohne die soziale Marktwirtschaft hätte schon die Wiedervereinigung nicht geklappt, und auch heute wird diese Wirtschaftsform die Probleme der Wirtschaftskrisen und der Wirtschaftskriminalität lösen, wozu eine sozialistische Planwirtschaft nie in der Lage wäre!
- Und: Ein dritter Weg war nie möglich, zu keiner Zeit! Die soziale Marktwirtschaft IST der dritte Weg! (zwischen Kommunismus und Kapitalismus).
- Und: Dritte Wege sind als Vision immer notwendig, aber eben nicht immer realisierbar. Auch die Medien dürfen träumen, aber ihre Aufgabe ist die Aufklärung und damit auch die Aufarbeitung.
Dies wollten wir den Politikern des letzten Podiums als Ergebnis der letzten Tage mit auf den Weg geben. Jetzt sind wir gespannt auf ihre Ideen, Wünsche und praktischen Vorschläge. Dabei meinen wir, dass sachlich Notwendiges auch gegen Widerstände durchgesetzt werden sollte, vordringlich jetzt vor allem:
- eine neue Initiative für die Opfer (Opferrente, Haftentschädigung) und
- eine bessere Information vor allem der Jugendlichen.
Bei diesen aktuellen Problemen erwarten wir auch eine gewissen Prinzipientreue, die sich nicht durch tagespolitischen Gegebenheiten abschrecken lässt.
2. Treffen Flüchtlinge/Fluchthelfer am 13. August 2010
Liebe Freunde,
wie schon im letzten Jahr wollen wir uns an UNSEREM Gedenktag treffen. Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt:
- Wir treffen uns am 13. August 2010 um 17.00 Uhr
- vor dem Haus Schönholzer Straße 7 in 10115 Berlin, wo der „Tunnel 29“ endete (Parallelstraße zur Bernauer Straße; fast neben dem U-Bahnhof Bernauer Straße; dort finden Sie auch Parkplätze, und auf dem gegenüberliegenden unbebauten Grundstück können sich auch viele Menschen treffen!);
- der Verein „Berliner Unterwelten“ macht dann in Gruppen von max. 20 Teilnehmern eine Führung zu den Tunneln in der Bernauer Straße (u.a. „Tunnel 57“ und der „verratene Tunnel“);
- ca. 5 Gruppen werden begleitet von ehemaligen Tunnelbauern, die an „ihrem“ Tunnel ihre Geschichte erzählen;
- um 19.00 Uhr treffen wir uns dann in der Versöhnungskapelle in der Bernauer Straße (es gibt dort leider nur ca. 100 Sitzplätze);
- die kleine Gedenkfeier dort wird mit Lautsprechern auch auf das Gelände vor der Kapelle übertragen;
- ab 20.00 Uhr/20.30 Uhr treffen wir uns im Bella Italia in der Brunnenstr. 104, direkt am U-Bahnhof Gesundbrunnen, 2 U-Bahn-Stationen weg von der Bernauer Straße.
...
Ihr/Euer Burkhart Veigel
REDEN
Pfarrer Fischer begrüßte uns Flüchtlinge und Fluchthelfer ganz herzlich in der Kapelle der Versöhnung. Er freue sich, dass wir seine Gemeinde als Anlaufpunkt für unsere Treffen gewählt haben.
...
Wir haben Freiheit nicht proklamiert oder angemahnt, wir haben sie gelebt und erlebt! Und stehen heute deshalb auch manchmal fassungslos da, wenn wir sehen, wie leicht manche Menschen die Freiheit für ihre Sicherheit hergeben.
Mit großer Trauer muss ich Ihnen berichten, dass am 10.6.2010 Dieter Thieme, einer meiner Lehrmeister und der jahrzehntelange ganz enge Freund von Detlef Girrmann, gestorben ist. Er war auch zuletzt stolz auf das, was er am Anfang der 60er-Jahre geleistet hat, und dass das in dem Buch von und über Uwe Johnson jetzt in der Öffentlichkeit besser bekannt und anerkannt wird. Viele von Ihnen haben ihn gekannt oder zumindest von ihm gehört. Ich möchte Sie bitten, sich für einen Moment des Gedenkens von Ihren Plätzen zu erheben.
...
Gestern hat Frau Dr. Nooke von der Mauergedenkstätte in der Bernauer Straße einen Abend organisiert, an dem Briefe von gerade Geflüchteten vorgelesen wurden. Sie haben mich vor allem deshalb berührt, weil ich hier nahezu identische Gefühle herausgehört habe, die auch mich nach der hermetischen Abriegelung der Grenzen bewegten: Auch ich stimmte dem Satz „Lieber tot als rot!“ bedingungslos zu, auch ich hasste diesen Staat und seine Vertreter; zwei Dinge, die man heute nicht mehr in den Mund nehmen würde – weil die Zeiten so total unterschiedlich sind wie sie nur sein können: Es gibt nach der friedlichen Revolution und nach dem Fall des Kommunismus keinen kalten Krieg mehr in Mitteleuropa, und allein da lässt unsere früheren Gedanken heute wie Monster aussehen. Aber diese Gedanken sind genauso wahr wie unsere heutigen; sie entstammen einfach einer anderen Zeit; und sie haben uns motiviert, Dinge zu tun, auf die wir heute noch mit Recht stolz sind!
Und weil wir stolz sind, und weil wir beim 13. August auch an Freiheit denken, für die wir eingetreten sind, dürfen wir an einem solchen Tag auch feiern. Und das tue ich sehr gerne mit Ihnen allen zusammen hier und jetzt!
...
Frau Stahmer hielt ihren Vortrag wieder – wie beim letzten Mal – völlig frei, losgelöst von dem Konzept, das sie sich gemacht hatte. Aus ihren Unterlagen und einigen Gesprächen kann der Inhalt wie folgt wiedergegeben werden:
Die unterschiedliche Sozialisation in Ost und West wurde für Viele erst nach den Jubelfeiern in der Folge des 9. November 1989 sichtbar,
- wenn sie am selben Tisch saßen und die gleiche Arbeit verrichteten, aber unterschiedlich bezahlt wurden,
- wenn die Einen vor allem wirtschaftlich aufholen und auf das Niveau der Anderen kommen wollten, die Anderen aber ihr Niveau um jeden Preis halten wollten,
- wenn sie feststellten, dass sie zwar den gleichen Beruf, aber ganz unterschiedliche Ausbildungen dafür hatten,
- wenn die einen Frauen fragten, in welche Kita sie jetzt ihr Kind schicken sollten, um weiterarbeiten zu können, die anderen aber wegen der gut ausgebildeten „Zuwanderer“ und der global einsetzenden Deindustrialisierung ihre Arbeit verloren,
- wenn sie soziale Fragen berührten, dabei aber zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kamen.
Diese und ähnliche Schwierigkeiten hatten auch alle Flüchtlinge, die seit dem Bau der Mauer in den Westen kamen. Aber sie gingen sie in der überwältigenden Mehrheit als Folge einer persönlichen Entscheidung aktiv an, passten sich dem westlichen System an, arbeiteten häufig mehr als ihre Kollegen, diskutierten mit und brachten sich und ihre Sichtweise der Dinge in ihre neue Umgebung ein, waren stolz auf das, was sie geleistet hatten und noch leisteten.
Der plötzliche Mauerfall und die bald folgende Vereinigung betraf aber alle in Ost und West; es waren keine individuellen Entscheidungen. In einer solchen Situation seine Identität in einem gemeinsamen Deutschland wieder zu finden, erfordert Zeit, Geduld und viel Aufeinanderzugehen. In Berlin hatten wir mehr Gelegenheit dazu, viele individuelle Gespräche zu führen, miteinander Erfahrungen zu machen und gegenseitige Empathie zu entwickeln als im Rest der Republik, sei es in Leipzig oder in Bonn. Auch deshalb ist es wichtig, den Schleier von den Fluchtgeschichen zu nehmen und auch die Zeit von 1961 bis 1989 als gemeinsame Geschichte zu begreifen.
Bilder
3. Treffen Flüchtlinge/Fluchthelfer am 13. August 2011
Ein Kreis von Flüchtlingen und Fluchthelfern, die Stiftung Berliner Mauer sowie die Evangelische Versöhnungsgemeinde nehmen den 50. Jahrestag des Mauerbaus zum Anlass, Sie alle zu einem gemeinsamen Treffen im Rahmen der Veranstaltungen zum 13. August in der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße einzuladen.
Treffpunkt: 13. August 2011 um 18.00 Uhr in der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße 4, Einmündung Hussitenstraße.
Ab 13 Uhr informieren wir Sie gerne ausführlich an einem Informationsstand vor der Kapelle über den weiteren Ablauf des Tages und über das Treffen am Abend. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dabei in eine Liste eintragen würden, damit wir Sie zu weiteren Treffen und anderen Aktivitäten von Flüchtlingen und Fluchthelfern einladen können.
Im Anschluss an unsere gemeinsame Veranstaltung in der Kapelle wollen wir uns in den Räumen des Vereins Berliner Unterwelten treffen. Näheres wird beim Treffen noch bekannt gegeben.
Dr. Burkhart Veigel für die Fluchthelfer
Dr. Maria Nooke, Gedenkstätte Berliner Mauer
Pfarrer Manfred Fischer, Versöhnungsgemeinde
Zeitplan:
0 bis 6 Uhr Lesung der Lebensläufe zahlreicher Menschen, die an der Mauer umgekommen sind, in der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße
ab 13 Uhr Stand vor der Kapelle mit näheren Informationen zum Treffen der Flüchtlinge und Fluchthelfer um 18 Uhr; hier können Sie auch mein - signiertes - Buch kaufen.
ab 15 Uhr Signierstunde meines Buches im Büchershop des Besucherzentrums der Gedenkstätte
Um 15.40 Uhr können Sie am Podium in der Ackerstraße Auszüge aus dem Buch von Maria Nooke und Lydia Dollmann "Fluchtziel Freiheit" hören, Berichte von Flüchtlingen unmittelbar nach ihrer Flucht.
ab 15.45 Uhr können Sie im Zeitzeugen-Cafe mit Evi Rudolph und Hans-Joachim Tillemann, Flüchtlingen im "Tunnel 57", und mit den Fluchthelfern Achim Rudolph und Klaus von Keussler, der gerade mit Peter Schulenburg zusammen das Buch über die Fuchs-Gruppe "Fluchthelfer" herausgegeben hat, sprechen.
Ab 16 Uhr werde ich mit Peter Schulenburg und Achim Neumann, zwei weiteren Fluchthelfern, zusammen auf dem Podium in der Ackerstraße von Frau Nooke über die Hintergründe unserer Fluchthilfe befragt.
Um 18 Uhr beginnt in der Kapelle der Versöhnung das 3. Treffen von Flüchtlingen und Fluchthelfern mit Ansprachen von Pfarrer Manfred Fischer, Frau Prof. Ingrid Stahmer, eines Flüchtlings, der am 13. August 1961 durch die Spree geschwommen ist, einer Fluchthelferin, die ihren Bruder und ihre Mutter nach West-Berlin holte, und eines Grenzers, der am 13. August 1961 die Grenzgänger zurückweisen musste und später in den Westen flüchtete.
Ab 20 Uhr wollen wir uns in den Räumen des Berliner Unterwelten e.V. treffen und unser jährliches Wiedersehen feiern. Einzelheiten kann ich Ihnen erst beim Treffen in der Kapelle sagen.
Reden
Ich muss Ihnen zunächst mit großer Trauer berichten, dass Detlef Girrmann am 8. April diesen Jahres gestorben ist. Er war schwer herzkrank und hing seit dem Tod seines besten Freundes Dieter Thieme im letzten Jahr nicht mehr so sehr am Leben, dass er gegen den Tod hätte kämpfen wollen. Viele von Ihnen kennen Detlef Girrmann noch aus seiner „aktiven“ Zeit, als er einer der drei Leiter der sog. Girrmann-Gruppe war. Für mich war er ein lebensrettender Lehrmeister in Sachen Fluchthilfe.
...
Unser diesjähriges Treffen läuft etwas anders ab, als Sie das gewohnt sind: Es sprechen nacheinander jetzt drei Menschen, für die der 13. August 1961 eine ganz besondere Bedeutung hatte: ein Flüchtling, der an diesem Tag durch die Spree schwamm, eine Fluchthelferin, die ganz spontan ihren Bruder und ihre Mutter in den Westen holte, und ein Grenzer, der die Schließung der Grenze auf eine ganz andere Weise erlebte.
Manfred Wester flüchtete am 13. August durch die Spree zu seiner Arbeitsstelle in die Freiheit.
Manfred Wester, Jahrgang 1939, musste mit 16 Jahren seine Schule in Biesdorf in Ost-Berlin verlassen, weil er nicht in die FDJ eingetreten war und darüber hinaus auch noch ungenügende Zensuren in Gemeinschaftskunde und Geschichte hatte. Er machte deshalb eine Drogisten-Lehre in West-Berlin und arbeitete dann als Grenzgänger in West-Berlin. Am 13. August war es zu Hause in Biesdorf, als er von der Schließung der Grenze hörte.
Er fuhr sofort zur Grenze, sprang in die Spree und schwamm nach West-Berlin. Seine Familie sah er erst Jahre später wieder.
Nach seiner Flucht machte er Abitur auf dem 2. Bildungsweg und studierte anschließend mit Abschluss zum Diplom-Kaufmann. Seit 1974 arbeitet er nach entsprechenden Prüfungen als Steuerberater und Buchprüfer in eigener Praxis.
Die Eltern von Frau Steffen waren schon immer Sozialdemokraten, auch während der Zeit des Nationalsozialismus. Deshalb setzten sie zunächst große Hoffnungen auf eine antifaschistische SBZ. Vor allem ihre Mutter sah aber schon 1946, dass die Sowjetunion selbst eine Diktatur war und dem Vasallenstaat DDR eine neue Diktatur aufzwang, die kein Haar besser war als die der Faschisten.
Die Mutter wurde 1946 bei den letzten einigermaßen freien Wahlen Bezirksverordnete der SPD in Weißensee, konnte die Funktion aber kaum wahrnehmen. So blieb nur ein Ausweg: Der Vater und 3 der 4 Kinder gingen in den Westen, Lydia Steffen noch aus einem besonderen Grund: Sie flog mit 15 Jahren von der Oberschule, weil sie sich in einem Aufsatz über ein sowjetisches Heldenepos kritisch geäußert hatte. Mit ihr wurde rund die Hälfte der Klasse unter verschiedenen Begründungen von der Schule geworfen. Sie ging deshalb als Grenzgänger-Schülerin weiter zur Schule in West-Berlin, machte da das Abitur und schlug eine Beamtenlaufbahn in West-Berlin ein.
Fluchthilfe und Flucht im August 1961
Von den Absperrungen am 13.8. erfuhr ich bereits um ca. 5.30 Uhr durch einen Anruf meines Bruders Norbert (Westberliner wie ich). Der damals 24-Jährige war in der Nacht vom 12. zum 13. mit etlichen Freunden aus Ost und West um die östliche Friedrichstraße herum auf Vergnügungstour. Dabei bekamen die jungen Leute in den frühen Morgenstunden den Beginn der Sperrmaßnahmen mit. Mit einem der letzten durchgehenden Züge erreichten sie Westberlin. Einige der Ostberliner Freunde fuhren gleich mit und trafen damit in wenigen Minuten eine ihr Leben verändernde Entscheidung. Mein Bruder wollte wissen, ob unser jüngster Bruder Ini (22 Jahre, Ostberliner) bei mir wäre. Er war es nicht, was bedeutete, daß er zusammen mit unserer Mutter in Weißensee festsaß.
Wie viele Berliner hatten wir längst damit gerechnet, dass die DDR etwas Gravierendes unternehmen würde, um die Flucht ihrer Bürger zu stoppen. Aber dass man Berlin völlig durchtrennen könnte, war nicht vorstellbar.
Die Reportagen, die an diesem frühen Sonntagmorgen über die Westberliner Sender liefen, lösten Fassungslosigkeit und Entsetzen aus. Als von den westlichen Alliierten keine Reaktion kam, glaubte ich zunächst an eine bürokratische Panne. Womöglich hatte man so früh und auch noch an einem Sonntag niemanden, der Entscheidungsbefugnisse hatte, erreichen oder aus dem Bett kriegen können! Aber schließlich begriff ich: Die DDR- Absperrungen des Ostsektors sind auf Dauer ausgelegt und die Westmächte werden nicht einschreiten. Verzweiflung und das Gefühl „jetzt lässt uns die ganze Welt im Stich“ machten sich breit.
Diese Empfindungen schlugen dann aber mehr und mehr in Wut um. Ich sagte mir: Nein, das nehme ich nicht einfach tatenlos hin. Ich kann den Gang der Geschichte zwar nicht aufhalten, aber ich werde mich wehren und tun, was mir möglich ist.
Ich war damals Personalsachbearbeiterin (Beamtin) im Rathaus Kreuzberg. Am 15.8., als ich in meinem Büro saß, verbreitete sich das Gerücht, dass die DDR demnächst Westberliner nur noch mit Passierschein in den Ostsektor lassen würde. Da klingelten bei mir alle Alarmglocken. Ich ging zu meinem Chef, dem damaligen Bürgermeister Willy Kressmann, und meldete mich mit der Erklärung ab, ich müsse jetzt meinen Bruder aus dem Ostsektor herausholen. Er sagte dazu nur „Melde Dich, wenn Du wieder im Westen bist, sofort telefonisch in meinem Sekretariat zurück!“
Ich suchte meinen Bruder Norbert auf seiner Neuköllner Arbeitsstelle auf und ließ mir seinen Personalausweis – ein schrecklich vergammeltes Ding , auf dem nicht mehr alles deutlich zu lesen war (was ich nicht für ungünstig hielt) – geben, um damit unseren jüngsten Bruder aus dem Osten herauszubringen.
Die beiden Brüder sahen sich – abgesehen von den differierenden Augenfarben blau und braun - ziemlich ähnlich, und ich hoffte einfach, dass die Unterschiede bei einer Kontrolle nicht bemerkt werden würden.
Zweifel daran, dass Ini aus dem Osten weg wollte, gab es eigentlich nicht. Er war bereits seit längerer Zeit Grenzgänger und hatte schon einmal – ich glaube als 16-jähriger - 5 Monate im Knast verbracht, nachdem er zusammen mit anderen Jugendlichen in einem politischen Schauprozess wegen Zusammenrottung und Landfriedensbruch verurteilt worden war.
Dennoch konnte ich nicht sicher sein, ob er eine Flucht mit dem Ausweis seines älteren Bruders wagen würde. Für den Fall, dass er dazu nicht bereit wäre, wollte ich wenigstens noch etwas für die Versorgung von Mutter und Bruder in Weißensee getan haben. Deshalb tauschte ich Westgeld in Ostgeld um und versteckte es u.a. in meiner (damals modernen) Hochfrisur. Außerdem kaufte ich auch begehrte Westwaren – Südfrüchte, Kaffee und Zigaretten – ein. Ich transportierte sie in einem offenen Netz in der Hoffnung, dass sich die Grenzkontrolle darauf fixieren und von weiteren Untersuchungen – etwa meiner Handtasche – absehen würde.
Als Grenzübergang wählte ich den U-Bahnhof Friedrichstraße. Auf die dort postierten Vopos ging ich mit großer Selbstsicherheit zu, denn meine innere Stimme sagte mir ständig: Alle Menschenrechte sind auf deiner Seite, niemand wird dich aufhalten.
Tatsächlich war es auch so. Die jungen Vopos warfen nur einen flüchtigen Blick auf meinen Ausweis und ließen mich passieren.
Als ich in Weißensee ankam, war Ini nicht zu Hause. Er hatte sich schon mit der Unveränderlichkeit der Lage abgefunden und wieder Arbeit als gelernter Kupferschmied in Weißensee aufgenommen.
Ich mußte also einige Stunden auf ihn warten. Als er nach Hause kam und ich ihm den Ausweis seines Bruders zeigte, ging alles ganz schnell. Wir kontrollierten, daß an seiner Ausstattung absolut nichts auf östliche Herkunft schließen ließ, und die Hosentaschen wurden mit Westzigaretten (er war starker Raucher) bestückt.
Wir beschlossen, zusammen über den Kontrollpunkt Friedrichstraße/Zimmerstraße nach Westberlin zu kommen.
Ich hielt diesen Übergang für geeignet, weil er von Kreuzberg aus voll einsichtig war und ich zumindest sicher sein wollte, dass eine eventuelle Festnahme dort registriert werden würde.
Wir fuhren mit der BVG bis zur Leipziger Str. Ecke Friedrichstr. Dann gingen wir zu Fuß die Friedrichstraße entlang in Richtung Grenze.
Es herrschte dort am späten Nachmittag eine merkwürdige Stille auf dem letzten Stück Osten der Friedrichstraße. Mir wurde plötzlich bewusst, was für ein auffälliges Paar wir hier waren. Jung, blond, groß (Ini 1,88 m), attraktiv. Ich fühlte, dass wir aus vielen Augen beobachtet wurden (Stasi war unübersehbar präsent).
Als wir uns in Höhe der Mauerstr. befanden, setzten sich mehrere Vopos in Bewegung. Ich flüsterte meinem Bruder noch schnell zu, dass er keinen Ton sagen und lieber rauchen solle; wenn es etwas zu reden gäbe, würde ich das machen.
Die Vopos bildeten einen Kreis um uns. Der leitende Offizier forderte uns auf, uns auszuweisen. Er unterzog uns einem Verhör, das in etwa so ablief:
Er: Sie heißen beide Buchwald. Sind Sie verwandt?
Ich: Ja, wir sind Geschwister, sieht man doch, nicht wahr?
Er: Wo kommen Sie jetzt her?
Ich: Aus Weißensee.
Er: Was haben Sie da gemacht?
Ich: Einen Besuch.
Er: Bei wem?
Ich: Bei unserer Mutter.
Er: Sie sind beide Westberliner und Ihre Mutter wohnt in Weißensee?
Ich: Ja, das ist in dieser Stadt nichts Ungewöhnliches. Wir sind volljährig und längst aus dem Haus.
Er: Besuchen Sie Ihre Mutter oft?
Ich: Na, künftig wahrscheinlich wesentlich häufiger, denn sie kann ja nun nicht mehr zu uns kommen.
Er: Sie sind also richtige Berliner?
Ich: Ja, das stimmt.
Er plötzlich: Wissen Sie, ich heiße nämlich auch Buchwald, ich bin aber kein Berliner (er sagte auch noch, woher er kam, aber das ist mir inzwischen entfallen).
Der Offizier betrachtete weiterhin den Ausweis meines Bruders. Es herrschte Stille. Um die zu unterbrechen, sagte ich: Ja, ja, der Ausweis sieht ziemlich mitgenommen (!) aus. Ich habe meinem Bruder schon lange gesagt, er solle sich mal einen neuen machen lassen.
Er: Ja, das dürfte wohl notwendig sein. Sie können gehen (er gab uns die Ausweise zurück)!
In Westberlin angekommen, meldete ich mich tel. im Sekretariat von Willy Kressmann. Dann fuhren wir zu unserem Bruder Norbert in die Görlitzer Str. in Kreuzberg, wo uns lautstarker Beifall empfing. Seine Ladenwohnung war voll belegt mit jungen Leuten aus Ostberlin, die noch während der ersten Absperrmaßnahmen flüchten konnten.
Am nächsten Tag, dem 16.8., holte ich mit der Ausweismasche unsere 59-jährige Mutter in den Westen. Das war eine Verzweiflungshandlung und alternativlos.
Meine Mutter hatte sich im April 1946 der Zwangsvereinigung von KPD und SPD widersetzt und war bei den ersten und letzten freien Wahlen am 20.10.1946 für die SPD in die Bezirksverordnetenversammlung Weißensee gewählt worden. Sie war in all den rückliegenden Jahren Druck und Bespitzelung ausgesetzt gewesen.
Offenbar in einer Art Rauschzustand, hielt ich mich am nächsten Tag für fähig, noch ein letztes Mal auf Tour zu gehen. Ich fragte Willy Kressmann: Kennen Sie einen politisch besonders gefährdeten Menschen im Ostsektor und könnten Sie mir für den einen ordentlichen Ausweis verschaffen? Seine Reaktion: Weißt Du was? Du kannst mal wieder arbeiten gehen!
Und damit war meine kurze Karriere als Fluchthelferin beendet.
Rudi Thurow wurde 1937 geboren; sein Vater starb 1944, seine Mutter 1945. Die 4 Kinder der Familie wurden unter den Verwandten aufgeteilt; er kam zu einem Onkel in Leipzig, der überzeugter Parteigänger zuerst der Nazis und dann der SED war und ihn mit brutaler Härte auf seine Linie zwingen wollte, was zur Folge hatte, dass Rudi wenigstens 20 Mal von zu Hause ausriss. Deshalb besuchte er neben der achtjährigen Grundschule auch immer wieder verschiedene Jugendheime; durch erneutes Ausreißen konnte er einmal auch die Einweisung in einen Jugendwerkhof verhindern.
In seiner Jugend ging es eindeutig nur ums Überleben. Für die sozialistische Politik hatte er kein Interesse. Wie alle ging er zu den Jungen Pionieren und in die FDJ. Nach einer Lehre als Bergknappe meldete er sich 1954 mit 17 Jahren zur kasernierten Volkspolizei und dann zu den Grenztruppen. Seine Vorstellung von seinen künftigen Aufgaben war, dass er Schieber und Schmuggler jagen würde. In Wirklichkeit kontrollierte er ab 1957 die Reisenden an der Grenze zwischen der Zone und Ost-Berlin. Viele der Menschen, die die Grenze regelmäßig passierten, kannte er mit der Zeit. Wenn aber unbekannte Gesichter auftauchten, die vielleicht noch einen Rucksack oder einen Koffer dabei hatten, musste er sie durchsuchen und verhören. Wenn sie ihre Zeugnisse bei sich trugen oder keinen hinreichenden Grund für ihren beabsichtigten Besuch in Ost-Berlin angeben konnten, wurde ihnen sofort der Ausweis abgenommen. Wenn sie nur verdächtig waren, erhielten sie einen neuen Ausweis mit einer Markierung „Nicht gültig für Berlin“; sie wurden nach Hause zurückgeschickt bei gleichzeitiger Information der regionalen Volkspolizei. Wenn der Verdacht auf den Versuch einer Republikflucht konkreter war, wurden die Delinquenten verhaftet und zur Stasi abtransportiert. Von denen hörte Rudi Thurow nie wieder etwas.
Rudi machte diese Arbeit, weil er nichts anderes kennengelernt hatte. Erst als seine Freundin mit einer Hose und Zigaretten aus West-Berlin zurückkam, verhaftet und mehrfach verhört wurde wegen angeblicher Devisenschieberei, und als ihm der Kontakt zu ihr unter Androhung von Arrest untersagt wurde, kamen ihm Bedenken, ob denn sein Dienst und sein Leben überhaupt so richtig seien. Diese Gedanken führten dazu, dass er beschloss, zu flüchten. Dabei wollte er auch 3 Bürgern der DDR helfen, die ihn im Lauf eines halben Jahres langsam ausgeforscht und dann darum gebeten hatten, sie mitzunehmen auf seinem Weg durch die Mauer.
Nur um zu zeigen, welche Welt das damals war: Einige Tage vor der geplanten Flucht verliebte sich einer der Flüchtlinge in eine Lehrerin, die er gerne mitnehmen wollte. Allerdings trug die ihr Partei-Abzeichen voller Stolz auf der Brust. Da sagten ihm Rudi und die beiden Anderen: „Wenn Du der EIN Wort von unserer Flucht erzählst oder wenn die Flucht nicht gelingt, weil Du zu viel erzählt hast, erschießen wir Dich als Ersten sofort an der Grenze!“ So konnte eine beginnende Liebesgeschichte auch ohne happy end glücklich enden – durch eine geglückte Flucht in die Freiheit.
Bericht Rudi Thurow: Der 13. August und seine Folgen
Ich hatte als Schichtführer den Bahnhof Bernau zwischen der Sowjetzone und Ost-Berlin zu kontrollieren. In den letzten Tagen vor dem 13. August kamen bei mir täglich einige Tausend Menschen durch, die noch versuchten, über Ost-Berlin nach West-Berlin zu entkommen, weitaus mehr als in den Monaten davor. Viele von ihnen ließ ich passieren, aber einige musste ich auch zurückschicken, wenn ihre Fluchtabsicht zu offensichtlich war. Sie beschimpften mich oder baten um Einsicht, dass sie doch nur kurz nach Ost-Berlin fahren wollten. Aber ich musste hart sein, weil auch ich ständig unter Kontrolle meiner Vorgesetzten stand.
In den Nachmittagsstunden des 12. August kamen auch viele Züge durch, die mit Panzern, Artillerie und Kampfgruppen der NVA besetzt waren, und viele, die Tausende von Rollen mit Stacheldraht geladen hatten. Normalerweise fuhren solche Züge zu einem Manöver Richtung Ostsee, jetzt fuhren sie nach Ost-Berlin. Wir glaubten damals, dass sie in Ost-Berlin wohl eine große Militärparade abhalten wollten.
Meine Schicht am 12. August endete um 22 Uhr. Wir fuhren und gingen in unsere Kaserne, reinigten noch die Waffen und legten uns dann schlafen. Etwa um 24 Uhr gingen die Alarmsirenen an: Dreimaliges langes Heulen bedeutete Gefechtsalarm; d.h., die Kompanie hat innerhalb von 3 Minuten auf dem Hof anzutreten, mit einer doppelten Ration an Munition und Verpflegung und mit panzerbrechenden Waffen. So etwas hatten wir alle noch nicht erlebt. Ich dachte, jetzt ist der Krieg ausgebrochen.
Nach unserer Meldung der Gefechtsbereitschaft verlas der Kompaniechef in Begleitung eines Sowjet-Offiziers dann den „Tagesbefehl“ des Verteidigungsministers: Wir sollten den Angriff der faschistischen Nato-Truppen auf die DDR verhindern, damit der Sozialismus und der Friede in Europa gerettet werden könnten. Da fragte ein junger Grenzsoldat ganz laut: „Müssen wir im Ernstfall unsere Schusswaffen gegen unsere Brüder und Schwestern in der Bundesrepublik gebrauchen?“ Die Antwort kam prompt: „Das sind keine Brüder und Schwestern, das sind Imperialisten und Faschisten!“
Dann durften wir schlafen, standen aber am 13. August um 6 Uhr schon wieder an der Grenze. Dort musste ich den oft völlig ahnungslosen Grenzgängern sagen, dass Berlin abgeriegelt sei, dass sie dort nie mehr hinkommen könnten und dass sie sich eine Arbeit in der DDR suchen sollten. Einige musste ich auch mit körperlicher Gewalt von einem Grenzdurchbruch abhalten. Als am Montag die Situation mit den vielen Grenzgängern eskalierte, wurden viele auch auf LKWs der Volkspolizei in die Kiesgrube bei Rüdersdorf gefahren, wo sie zur Disziplinierung einige Tage Zwangsarbeit verrichten mussten. Ich habe auch selbst gesehen, wie Kleingarten-Kolonien an der Grenze zu West-Berlin niedergewalzt wurden, damit sich dort niemand mehr verbergen konnte. Und ich habe erlebt, dass junge Rekruten nicht bereit waren, den Fahneneid auf die DDR abzulegen; von denen habe ich dann nie wieder etwas gehört.
Am 21. Februar 1962 konnte ich im Kugelhagel mit einer Frau und 2 Männern nach Steinstücken, einer West-Berliner Exklave, flüchten, von wo ich dann in einer amerikanischen Uniform im Hubschrauber nach West-Berlin ausgeflogen wurde. Später habe ich lange Zeit in der Girrmann-Gruppe mitgeholfen, Flüchtlinge durch die Mauer in den Westen zu holen. Die Stasi versuchte zwei Mal, mich zu entführen, aber ich hatte beide Male Glück und entkam. Aber erschreckt war ich doch, als ich das alles in meinen Stasi-Akten las. Heute führe ich häufig Besuchergruppen durch Berlin zu den Brennpunkten des Kalten Kriegs.


















































































